Christian Drosten bei turi2:
Lizenz zum Hören – Diemut Roether über 100 Jahre Radio in Deutschland.

Ohrhang auf: Am 29. Oktober 1923 geht in Deutschland das erste Radioprogramm auf Sendung. Weniger als 300 Menschen können damals zuhören. Doch der Hörfunk wird rasch populär und erreicht bald ein Millionenpublikum. Diemut Roether skizziert bei epd medien die Entwicklung des Mediums in den vergangenen 100 Jahren und sagt ihm eine große Zukunft voraus. Denn auch im Online-Zeitalter, findet Roether, kann man vom Radio noch einiges lernen, etwa über Community Building, den Wert einer vertrauen Stimme – und die Kunst des Zuhörens.Von Diemut Roether / epd Medien
 “Achtung, Achtung, hier ist die Sendestelle Berlin Vox-Haus auf Welle 400 Meter.” Mit diesen Worten, gesprochen von Friedrich Georg Knöpfke, dem Direktor der Funkstunde Berlin, begann am 29. Oktober 1923 das erste offizielle Rundfunkprogramm in Deutschland: “Meine Damen und Herren, wir machen Ihnen davon Mitteilung, dass am heutigen Tage der Unterhaltungsrundfunkdienst mit Verbreitung von Musikvorführungen auf drahtlos telefonischem Wege beginnt. Die Benutzung ist genehmigungspflichtig.” Es folgte die Übertragung eines “Cello-Solos mit Klavierbegleitung Andantino von Kreisler”.
“Achtung, Achtung, hier ist die Sendestelle Berlin Vox-Haus auf Welle 400 Meter.” Mit diesen Worten, gesprochen von Friedrich Georg Knöpfke, dem Direktor der Funkstunde Berlin, begann am 29. Oktober 1923 das erste offizielle Rundfunkprogramm in Deutschland: “Meine Damen und Herren, wir machen Ihnen davon Mitteilung, dass am heutigen Tage der Unterhaltungsrundfunkdienst mit Verbreitung von Musikvorführungen auf drahtlos telefonischem Wege beginnt. Die Benutzung ist genehmigungspflichtig.” Es folgte die Übertragung eines “Cello-Solos mit Klavierbegleitung Andantino von Kreisler”.Die Entscheidung, dass an diesem Montagabend im Oktober die erste Radiosendung verbreitet werden sollte, fiel spontan. Seit einigen Monaten schon hatte Knöpfke, zuvor Prokurist und Werbeleiter der Vox Schallplatten- und Sprechmaschinen AG, zusammen mit dem Musiker Otto Urack im Auftrag des Staatssekretärs für das Funkwesen Hans Bredow an Sendungen für den Unterhaltungsrundfunk gearbeitet. Urack erzählte 30 Jahre später, nachdem er und Knöpfke Bredow ein einstündiges Programm vorgeführt hatten, habe der gesagt: “Kinder, das hat gut geklungen, wir fangen an.” Am selben Abend noch sei der Unterhaltungsrundfunk auf Sendung gegangen.
Der Kommunikationsapparat
Wer die neuen Radioprogramme hören wollte, musste sich als “Teilnehmer” anmelden. Nur rund 250 Menschen hatten im Oktober 1923 eine Lizenz, Radio zu hören, und ein Gerät, mit dem sie den Unterhaltungsrundfunk empfangen konnten. Und kaum einer ahnte wohl damals, dass das Radio in wenigen Jahrzehnten weltweit das populärste Medium schlechthin werden sollte.
In den ersten Monaten und Jahren suchte das neue Medium Radio noch nach seiner Form. Es war, wie der Schriftsteller Bertolt Brecht 1932 in seiner Rede “Der Rundfunk als Kommunikationsapparat” sagte, eine Erfindung, die nicht bestellt gewesen sei: “Nicht die Öffentlichkeit hatte auf den Rundfunk gewartet, sondern der Rundfunk wartete auf die Öffentlichkeit.” Vielleicht sollte man besser sagen: Er musste seine Öffentlichkeit finden. Und das geschah rasch.
Die “Funk-Stunde”, wie der erste – privat betriebene – Radiosender ab 1924 hieß, hatte in den ersten Monaten nur ein kleines Publikum: 1.580 Hörer zahlten im Januar 1924 die Teilnehmergebühr, 94 % kamen aus Berlin. Doch in den Jahren 1923 und 1924 gründeten sich weitere private Rundfunkgesellschaften in Frankfurt am Main, Königsberg, Hamburg, Leipzig, Stuttgart, Breslau, Münster und Berlin. Radio war zunächst privatwirtschaftlich organisiert, die ersten Radio-Gesellschaften wurden getragen von Unternehmen, die mit dem neuen Medium wirtschaftliche Hoffnungen verbanden: Sie wollten Schallplatten und Radiogeräte verkaufen.
Im Dezember des Jahres 1924 gab es bereits eine halbe Million “Teilnehmer” in Deutschland. Ein Jahr später hatte sich die Zahl verdoppelt. Zwei Reichsmark kostete 1924 – kurz nach der Inflation – die monatliche Teilnehmergebühr. “Schwarzhören” wurde im März 1924 unter Strafe gestellt.
Schnell erkannten die Radiomacher den Wert der Live-Berichterstattung, die “Blitzesschnelle des Rundfunks”: Bei den Reichstagswahlen am 4. Mai 1924 hatte der für die Presseangelegenheiten zuständige Direktor der Berliner “Funk-Stunde”, Theodor Weldert, “einen ganzen Stab an Helfern” um sich geschart, um über die Wahlen zu berichten, wie der Chefredakteur der Zeitschrift “Funk”, Ludwig Kapeller, damals beschrieb, beeindruckt von der “Raschheit der Nachrichtenübermittlung”.
In der Silvesternacht 1924/25 verließ der Reporter Alfred Braun das Studio der “Funk-Stunde”, um live von der Berliner Friedrichstraße über die Feier zum Jahreswechsel zu berichten. Seine Reportagen machten Braun zum berühmtesten Radioreporter seiner Zeit, schreibt der Rundfunkhistoriker Hans-Ulrich Wagner.
Viele verbanden mit dem neuen Medium Radio in seiner Frühzeit utopische Visionen. Der Physiker Albert Einstein sagte 1930 bei der Eröffnung der Deutschen Funkausstellung in Berlin, die Technik des Radios ermögliche “die wahre Demokratie”: Sie mache die Werke “der feinsten Denker und Künstler, deren Genuss noch vor Kurzem ein Privileg bevorzugter Klassen war, der Gesamtheit zugänglich”. Und Brecht forderte 1932: “Der Rundfunk ist aus einem Distributionsapparat in einen Kommunikationsapparat zu verwandeln. Der Rundfunk wäre der denkbar großartigste Kommunikationsapparat des öffentlichen Lebens, ein ungeheures Kanalsystem, das heißt, er wäre es, wenn er es verstünde, nicht nur auszusenden, sondern auch zu empfangen, also den Zuhörer nicht nur hören, sondern auch sprechen zu machen und ihn nicht zu isolieren, sondern ihn auch in Beziehung zu setzen.”
Goebbels: “Nur nicht langweilen”
Als die Nationalsozialisten 1933 in Deutschland an die Macht kamen, sahen sie im Radio ein Herrschaftsmittel, wie der Medienhistoriker Christoph Classen schreibt: “Dass das Medium nur in einer Richtung sendete, passte zu ihrem politischen Ideal einer direkten und andauernden Verbindung zwischen dem ‘Führer’ und einer ihm treu ergebenen ‘Volksgemeinschaft’.”
Der Hörfunk wurde zum Propagandainstrument. Joseph Goebbels, der im März 1933 das von Hitler neu geschaffene Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda übernahm, rief noch im selben Monat die Intendanten der Reichsrundfunkgesellschaft zusammen und sagte ihnen: “Der Rundfunk gehört uns! Niemandem sonst. Und den Rundfunk werden wir in den Dienst unserer Idee stellen. Und keine andere Idee soll hier zu Worte kommen.” Das “erste Gesetz”, das Goebbels verkündete, war: “Nur nicht langweilen.”
Hans Bredow, der in der Weimarer Republik inzwischen zum Reichsrundfunkkommissar ernannt worden war, hatte bereits am Tag der Machtergreifung durch Hitler, am 30. Januar 1933, seinen Rücktritt eingereicht. In einem Telegramm an Hitler protestierte er später gegen die Verhaftung seiner engsten Mitarbeiter und verlangte, ihr Schicksal zu teilen. Daraufhin wurde er auch verhaftet und verbrachte 16 Monate im Untersuchungsgefängnis Berlin-Moabit. Die regionalen Rundfunksender verloren ihre Selbstständigkeit, neuer Direktor der Reichsrundfunkgesellschaft wurde der NSDAP-Funktionär Eugen Hadamovsky, der später zum “Reichssendeleiter” ernannt wurde.
Der Propagandaminister hielt den Rundfunk für “das allermodernste und für das allerwichtigste Massenbeeinflussungsinstrument, das es überhaupt gibt”. Mit dem preiswerten “Volksempfänger” machten die Nationalsozialisten das Radio wirklich zum Massenmedium. Hatte es 1933 noch 4,2 Millionen Rundfunkteilnehmer gegeben, so waren es zehn Jahre später 16 Millionen. Nach Kriegsbeginn galt die Unterhaltung der “vielen Millionen deutscher Rundfunkhörer an der Front und in der Heimat durch musikalische Sendungen und künstlerische Wortsendungen” als kriegswichtig.
Am Tag des Überfalls auf Polen, am 1. September 1939, trat die “Verordnung über die außerordentlichen Rundfunkmaßnahmen in Kraft”, die es verbot, ausländische Sender zu empfangen. Denjenigen, die Nachrichten ausländischer Sender verbreiteten, drohte sogar die Todesstrafe. Zuwiderhandlungen wurden als “Rundfunkverbrechen” verfolgt. Im selben Monat wurde die Beschlagnahme der Rundfunkempfänger von Jüdinnen und Juden angeordnet.
Showdown in Stuttgart
Nach dem Krieg entstand in der Bundesrepublik unter der Führung der Alliierten dann ein Rundfunk, “der staatsfern, aber nicht unpolitisch sein sollte”, schreibt Classen. In der jungen Bundesrepublik wurde das Radio zur Schule der Demokratie.
Vor allem die Briten achteten darauf, dass “der Rundfunk vom Staat und von parteipolitischen Einflüssen unabhängig sein muß”, wie es Hugh Carleton Greene, der britische Chief Controller und von 1946 bis 1948 der erste Generaldirektor des Nordwestdeutschen Rundfunks in Hamburg, in seiner Abschiedsrede formulierte. Dass die deutschen Politiker das anders sahen, hat Greene mehrfach erzählt. Sein “guter Freund”, aber eben auch Gegenspieler, der damalige Hamburger Bürgermeister Max Brauer, habe ihm nach dieser Rede zugeraunt: “Es wird Ihnen nicht gelingen.”
Denn die deutschen Politiker waren überwiegend der Meinung, dass der Rundfunk als wichtiges Instrument der öffentlichen Meinungsbildung unter eine starke Kontrolle der Regierung gestellt werden müsste. Der frühere Vorsitzende der Historischen Kommission der ARD, Heinz Glässgen, hat einmal geschildert, wie es in Stuttgart gewissermaßen zum Showdown kam: Die Deutschen legten Gesetzentwürfe für den Rundfunk vor, “die Militärregierung legte ihr Veto ein. Dauernder Stein des Anstoßes: die beherrschende Stellung der Regierung.” General Lucius D. Clay habe im Dezember 1947 schließlich angeordnet, dass “bis spätestens 15. März 1948 gesetzliche Maßnahmen über das Rundfunkwesen zu erlassen” seien, die mit den von den Amerikanern geforderten Grundsätzen übereinstimmten.
Der liberale Ministerpräsident im Stuttgarter Landtag, Reinhold Maier, sagte im Juli 1949 resigniert: “Der deutsche Standpunkt konnte sich nur unter Bedenken der Auffassung anschließen, daß eine Rundfunkanstalt im Grunde niemandem gehöre, daß niemand eine Verantwortung trage, daß niemand einen Einfluß auszuüben habe.”
Bis heute muss die von den Alliierten verordnete Staatsferne des Rundfunks immer wieder verteidigt werden, wie zuletzt 2014 das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Besetzung der Gremien im ZDF zeigte. Der Einfluss “staatlicher und staatsnaher Mitglieder” müsse konsequent begrenzt werden, entschieden die Richter. Regierungsvertreter dürften auch keinen entscheidenden Einfluss auf die Besetzung der Gremienmitglieder ausüben.
Vertraute Stimmen
Bildung, Information, Unterhaltung – seine Funktionen haben es dem Medium Radio über die Jahrzehnte ermöglicht, sich immer wieder neu zu erfinden und populär zu bleiben. Es hat in den vergangenen 100 Jahren bewiesen, wie wandlungsfähig es ist. Die Empfangsgeräte wurden im Laufe der Zeit mobiler und kleiner und ließen sich überallhin mitnehmen. Inzwischen kann man auch über das Smartphone Radio empfangen. Mit der Digitalisierung findet das Radio neue Ausspielwege – und es versendet sich nicht mehr. Wer eine Sendung verpasst hat, kann sie jetzt in der Audiothek nachhören.
Das Radio ist ein Alltagsbegleiter, seine Beliebtheit nach 100 Jahren ungebrochen. Trotz der starken Konkurrenz von Fernsehen und Internet hören zwei Drittel der Menschen in Deutschland immer noch täglich Radioprogramme. Nach Angaben der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse gibt es derzeit mehr als 400 unterschiedliche Radiosender in Deutschland.
Mit dem Aufkommen des Privatradios in den 80er Jahren wurden die Wellen nach und nach vermeintlich passgenau für spezielle Zielgruppen formatiert. Lange Wortbeiträge galten vielfach als Störfaktor. Das könnte sich seit dem Erfolg der Podcasts wieder ändern. Gefragt sind gerade im Internet Persönlichkeiten und Stimmen, denen die Menschen vertrauen. Der im Februar 2020 vom NDR ins Leben gerufene Podcast “Coronavirus-Update” mit dem Virologen Christian Drosten gehörte nach einem Jahr mit insgesamt 86 Millionen Abrufen zu den erfolgreichsten Podcasts in Deutschland.
Überhaupt zeigte das Radio in der Pandemie, was seine Stärke ist: Es stellte Öffentlichkeit her in einer Zeit, in der es keine öffentlichen Veranstaltungen gab. In Gesprächssendungen konnten die Menschen über ihre Sorgen und Ängste reden, damit erfüllten die Sender eine wichtige Aufgabe: Sie brachten die Gesellschaft ins Gespräch mit sich selbst.
Kultur des Zuhörens
Denn Radiosender wissen schon lange, wie man den Dialog mit dem Publikum pflegt. Sie bildeten Communitys, bevor es das Internet und soziale Netzwerke gab. Zugleich wächst die Konkurrenz im Internet. Wenn Radio also relevant bleiben will, muss es vor allem Anlass zum Hinhören geben, Diskussionsstoff bieten, zum Weiterdenken anregen. Radioprogramme müssen sich unterscheiden, damit sie eingeschaltet werden. Wer Musik hören will, ist mit einer Playlist besser bedient als mit der heavy rotation der meisten populären Wellen.
Und je hitziger in den sozialen Netzwerken diskutiert wird, umso wichtiger wird die Kulturtechnik des Zuhörens, das Bemühen, die Argumente der anderen zu verstehen, bevor man ihnen entgegnet oder gar über den Mund fährt. Radio ist mehr als Musik oder Audiojournalismus, und entgegen den Behauptungen mancher Radioberater ist es auch mehr als Mood Management. Ein gut gestaltetes Programm überrascht und fordert sein Publikum auch mal heraus, es bietet Orientierung und hilft der Gesellschaft, sich selbst besser zu verstehen.
 Diemut Roether ist Mitherausgeberin des Buchs 100 Jahre Radio in Deutschland, veröffentlicht von der Bundeszentrale für politische Bildung.
Diemut Roether ist Mitherausgeberin des Buchs 100 Jahre Radio in Deutschland, veröffentlicht von der Bundeszentrale für politische Bildung.
Alle Beiträge aus der Reihe “Das Beste aus epd Medien bei turi2” >>>Foto: Picture Alliance / akg-images, epd
Zitat: Christian Drosten und Karl Lauterbach sind keine dicken Freunde geworden.
 “Die Medien sagen mir nach, ich wäre ganz nah an Angela Merkel dran gewesen oder an Karl Lauterbach. Das würde ich aber so nicht unterschreiben.”
“Die Medien sagen mir nach, ich wäre ganz nah an Angela Merkel dran gewesen oder an Karl Lauterbach. Das würde ich aber so nicht unterschreiben.”Virologe Christian Drosten sagt im “Spiegel”-Interview mit Karl Lauterbach, den Eindruck, er und der Gesundheitsminister seien dicke Freunde gewesen, “wollten vor allem so manche Journalisten verbreiten”. Ein Sonderverhältnis hätten sie nicht: “Wir siezen uns.”
spiegel.de (€)Virologe Christian Drosten fühlt sich bei Aussage zu Pandemie-Ende missverstanden.
 Hartnäckige Pandemie: Der Virologe Christian Drosten kritisiert im ersten Auftritt seit zehn Monaten im NDR-Podcast “Coronavirus-Update”, einige Medien und Politiker hätten ihn bewusst missverstanden. Seine Äußerung zum vermeintlichen Ende der Corona-Pandemie sei falsch interpretiert worden. Das endgültige Pandemie-Ende lasse sich nicht voraussagen. “Ich glaube, alle, die mich bisher kommunizieren gehört haben, wissen, dass ich solche forschen Dinge eigentlich nicht in der Öffentlichkeit sage”, so der Virologe im Podcast.
Hartnäckige Pandemie: Der Virologe Christian Drosten kritisiert im ersten Auftritt seit zehn Monaten im NDR-Podcast “Coronavirus-Update”, einige Medien und Politiker hätten ihn bewusst missverstanden. Seine Äußerung zum vermeintlichen Ende der Corona-Pandemie sei falsch interpretiert worden. Das endgültige Pandemie-Ende lasse sich nicht voraussagen. “Ich glaube, alle, die mich bisher kommunizieren gehört haben, wissen, dass ich solche forschen Dinge eigentlich nicht in der Öffentlichkeit sage”, so der Virologe im Podcast.
rnd.de, ndr.de (98-min-Audio), turi2.de (Background)Christian Drosten hält die Corona-Pandemie für überstanden.

Frohe Botschaft: Für Virologe Christian Drosten ist die Corona-Pandemie in Deutschland vorbei. Dem “Tagesspiegel” sagt der Wissenschaftler: “Wir erleben in diesem Winter die erste endemische Welle mit Sars-Cov-2, nach meiner Einschätzung ist damit die Pandemie vorbei.” Nach diesem Winter werde die Pandemie kaum mehr eine Rolle spielen, weil die Immunität der Bevölkerung dann entsprechend belastbar sei. Dass die Pandemie in China aktuell so eskaliert, begründet er mit dem dort fehlenden “Bewusstsein für das Impfen”.Justizminister Marco Buschmann fordert nach der Erklärung Drostens via Twitter ein Ende aller Pandemie-Maßnahmen. Drosten habe während der Pandemie zu den vorsichtigsten Wissenschaftlern gehört, wenn sein Befund nun laute, dass die Pandemie vorbei ist, müssten die letzten Schutz-Maßnahmen auslaufen. Bereits zuvor hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ein Ende der Maskenpflicht im Fernverkehr der Deutschen Bahn gefordert. Die Pflicht müsse zu einer freiwilligen Empfehlung werden – am besten bereits zum Jahreswechsel. (Foto: dpa)
tagesspiegel.de (Drosten), tagesschau.de (Buschmann), spiegel.de (Söder)Zitat: Christian Drosten hat sich von Twitter verabschiedet.
 “Das digitale Leben interessiert mich nicht mehr.”
“Das digitale Leben interessiert mich nicht mehr.”Virologe Christian Drosten, zu Pandemie-Hochzeiten ein Twitter-Intensiv-Nutzer, sagt im “Zeit”-Interview, dass er beim Kurznachrichtendienst schon “seit Monaten gar nicht mehr reingeguckt” hat. Er habe stattdessen digital drei Zeitungen abonniert und genieße “diesen journalistischen Filter sehr”.
zeit.de (€)Ein Spannungsfeld: Uwe Kammann fasst die Public-Value-Konferenz zusammen.
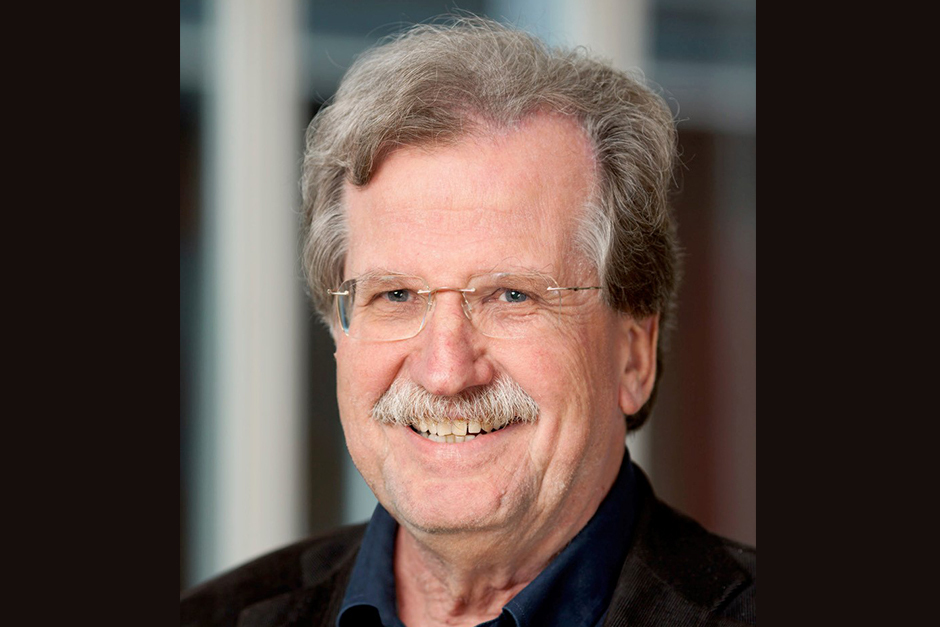
Konferenz-Kritik: Auf der Zweiten Europäischen Public-Value-Konferenz in Leipzig diskutieren Expertinnen, wie Medien Gemeinwohl durch Vielfalt erreichen können. Dass der Begriff Vielfalt “nicht auf einen einfachen Nenner” zu bringen ist und sich keine “einfachen Handlungsanweisungen ableiten” lassen, zieht sich “wie ein roter Faden durch die Tagung”, schreibt Uwe Kammann bei epd Medien. turi2 veröffentlicht den Beitrag in Kooperation mit epd Medien in der wöchentlichen Reihe Das Beste von epd Medien bei turi2.
Von Uwe Kammann / epd Medien
Mit der Frage, wie die Medien zum Gemeinwohl beitragen können, beschäftigte sich die Zweite Europäische Public Value Konferenz am 5. und 6. Oktober beim Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) in Leipzig. Die rund 40 Referentinnen und Referenten gingen bei der Tagung, die vom MDR gemeinsam mit der Handelshochschule Leipzig ausgerichtet wurde, auch der Frage nach, wie Journalismus und Wissenschaft bei der Bewältigung der Krisen unserer Zeit zusammenwirken können. Vertrauen sei jedenfalls ein wichtiger Schlüssel zu der Antwort auf die Frage, wie gesellschaftliche Kommunikation in einer sich immer stärker ausdifferenzierenden Gesellschaft gelingen kann, schreibt Uwe Kammann.
 Von multiethnisch bis multikulturell, von multilingual und auf jeden Fall auch zunehmend entgrenzt und global vernetzt: Es ist unübersehbar, dass unsere Gesellschaft sich immer stärker ausdifferenziert. Mit der Folge, dass auch jene Tendenzen zunehmen, die sich unter “heterogen” subsummieren lassen. Partikulares – gerade auch beim Anmelden von Interessen, seien es solche von Gruppierungen oder Individuen – scheint überproportional zuzunehmen, wird vielfach mit Vehemenz eingefordert.
Von multiethnisch bis multikulturell, von multilingual und auf jeden Fall auch zunehmend entgrenzt und global vernetzt: Es ist unübersehbar, dass unsere Gesellschaft sich immer stärker ausdifferenziert. Mit der Folge, dass auch jene Tendenzen zunehmen, die sich unter “heterogen” subsummieren lassen. Partikulares – gerade auch beim Anmelden von Interessen, seien es solche von Gruppierungen oder Individuen – scheint überproportional zuzunehmen, wird vielfach mit Vehemenz eingefordert.Bleibt dabei etwas auf der Strecke? Ist Gemeinsinn als wichtiges Integrationsmerkmal der Gesamtgesellschaft von vornherein als gestrig oder als überflüssig verdächtig? Bekommt Vielfalt als Eigenschaft ein Übergewicht im Zusammenleben? Und: Welche Funktion kommt bei diesem Prozess den Medien zu, speziell jenen, die in öffentlich-rechtlicher Verfassung in erster und in letzter Lesart dem Gemeinwohl verpflichtet sind?
Diese Fragen standen im Mittelpunkt eines Kongresses, der drei Jahre nach einer ersten Public-Value-Konferenz in Leipzig ausloten sollte, in welchem Verhältnis Gemeinwohl und Vielfalt zueinanderstehen, zueinander stehen sollten. Dass es sich um ein Spannungsfeld handelt, betonte ZDF-Intendant Norbert Himmler in seiner Videobotschaft.
Noch eindringlicher umriss Karola Wille, Intendantin des gastgebenden MDR, in ihrer Eröffnungsrede die inneren Spannungslinien. Wenn Vielfalt häufig mit immer größeren Ansprüchen im Einzelnen gleichgesetzt werde, wie sei dann auf der anderen Seite “das für eine funktionierende Gesellschaft notwendige Gemeinsame” zu suchen und zu schaffen? Denn dieses Verbindende und Gemeinsame sei schließlich ein wesentlicher Kern des Gemeinwohls.
Im Laufe der zwei Kongresstage ließ sich immer wieder fragen, ob Eigensinn und Gemeinsinn gleichsam natürliche Feinde oder im Ansatz doch ein Geschwisterpaar sind. Der Titel dieser zweiten Public-Value-Konferenz ließ allerdings eine vielleicht irritierende Eindeutigkeit mitschwingen: “Gemeinwohl durch Vielfalt in den Medien”. Das “durch” dürfte manche Fragezeichen provoziert haben.
Nun hat, was den Gesamtzusammenhang von Medien und Gesellschaft betrifft, gerade ein prominenter Autor eine ziemlich dunkle Diagnose geliefert, mit Blick auf den notwendigen Vernunftgrund eines aushandelnden Gesellschaftsdiskurses. Und so wurde Jürgen Habermas wegen seines aktuellen Buchs “Ein neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit” gleichsam zum abwesenden Star der Diskussion. Bei der Soziologin Jutta Allmendinger leuchtete der Buchumschlag am Pult signalrot auf, als sie die Tendenz zum Auseinanderdriften zwischen Ich und Wir beschrieb, obwohl doch jedes Individuum sich ohne einen ausreichenden sozialen Bezug nicht konstituieren könne.
Welche Folgerungen sich daraus für die Medien ergeben, wie eine zunehmend hybride Gesellschaft mit den individuellen Einzelpositionen und stets neu changierender Interaktionen alle herkömmlichen festen Beziehungen sprengt, das verdeutlichte ORF-Redakteur Klaus Unterberger in einem höchst anschaulichen “Wimmelbild”. Er, der beim ORF schon seit weit mehr als einem Jahrzehnt in zahlreichen Kolloquien die neuen Anforderungen an die gemeinwohlorientierten Medien erörtert, präsentierte auch in Leipzig kein Patentrezept.
Aber er demonstrierte eindringlich, dass die frühere Konstellation mit kuratierten, also von Profis konzipierten und gestalteten Programmen respektive Inhalten unwiederbringlich vorbei sei. Insofern müssten die Medienhäuser sich wesentlich verändern. Bei allen beunruhigenden und als bedrohlich empfundenen Verwerfungen und Disruptionen: Ein “Zugriff auf eine neue Identität” sei nicht möglich, “ob es moralisch gefällt oder nicht”.
Gleich anfangs hatte Karola Wille klargestellt, dass der im Public-Service-Gedanken verankerte gesellschaftliche Nutzen “im Diskurs mit der Gesellschaft immer wieder selbstkritisch reflektiert und belegt werden” müsse, er mithin kein Selbstläufer sei – und dies ganz unabhängig von den Verfehlungen an der Führungsspitze des RBB, die zwar das ganze System belasteten, aber nicht zu einer Pauschalverurteilung führen dürften.
Diese Differenzierung nahm später auch die rheinland-pfälzische Staatssekretärin Heike Raab auf. Sie sprach von einer “Vertrauenskrise”, die keine “Systemkrise” sei. Reformbedarf bestehe gleichwohl, doch seien die Länder, deren Rundfunkkommission sie steuert, bei der Gestaltung eines neuen Medien-Staatsvertrags auf einem “guten Weg”, um beispielsweise gesellschaftliche Ziele wie eine verstärkte Teilhabe und “echte Interaktion” zu erreichen.
Beim medienpolitischen Teil des Kongresses entspann sich eine Diskussion um das Vorhaben der Europäischen Kommission, mit einem European Media Freedom Act sowohl die privaten als auch die öffentlich-rechtlichen Medien in einen neuen regulatorischen Rahmen einzuspannen, mit einer bei der Kommission angesiedelten Aufsichtsbehörde (“The Board”); und dies als “Verordnung”, also verbindlich für alle Mitgliedsstaaten. Heike Raab zeigte Skepsis, ob diese neue Ebene Vielfalt fördern könne: “Ich will auch nicht alles regulieren.” Sie lobte das deutsche Mediensystem, das gerade in nicht-demokratischen Staaten als “absoluter Lichtblick” gesehen werde.
Tobias Schmid, Direktor der nordrhein-westfälischen Landesmedienanstalt, hielt erkennbar wenig bis gar nichts von diesem “ambitionierten Ansatz” der Kommission. Er sieht dabei wegen mangelnder Staatsferne Freiheiten ebenso in Gefahr wie die bislang national geprägten Kompetenzen bei der Medienregulierung, die damit auf einen “therapeutischen Gesprächskreis” reduziert werde.
Hintergrund solcher Regulierungsszenarien ist die Dominanz der amerikanischen Internetkonzerne, eine Vorherrschaft, der bislang keinerlei wirksame europäische Konstruktion entgegengesetzt wurde. Klaus Unterberger warnte eindringlich vor einem “Ausverkauf an Netflix und einem Appeasement gegenüber Google”, hatte allerdings auch kein Rezept parat.
Der Kommunikationswissenschaftler Christoph Neuberger vom Weizenbaum-Institut warb an diesem Punkt für starke eigene Initiativen, so mit der Gestaltung selbstbestimmter Plattformen: “Es sind andere Instrumente, andere Räume notwendig.” Er warnte davor, Vielfalt zu überschätzen, und verwies darauf, dass der früheren Mangelverwaltung heute eine “überbordende Fülle” im Netz gegenüberstehe. Vielfalt und Relevanz stünden in einem Spannungsverhältnis, sagte er. Ähnliches gelte für die Konsequenzen hinsichtlich gesellschaftlicher Erfordernisse: “Konsens ist das glatte Gegenteil von Vielfalt.”
Dass der Begriff Vielfalt nicht auf einen einfachen Nenner zu bringen ist, dass sich daraus nicht einfache Handlungsanweisungen ableiten lassen, das zog sich als roter Faden durch die Tagung. Schon bei der Einführung verwies Karola Wille auf die damit verbundenen Kontroversen und Polarisierungen bis hin zum Vorwurf des reinen Modethemas. Klaus Unterberger wiederum sieht die Gefahr eines im Establishment verorteten reinen “Elitediskurses”. Er warnte davor, Vielfalt als “rein positiven Bekenntniswert” zu verstehen: “Vielfalt funktioniert nicht als moralischer Imperativ.”
Immer wieder ging es natürlich auch um die Rolle der Netzplattformen, einmal als Konkurrenz, aber auch als Träger für öffentlich-rechtliche Inhalte, in Einzelfällen – wie beim Jugendangebot Funk – ausschließlich. Sabine Frank, Leiterin Government Affairs und Public Policy bei Youtube, stellte allen Vorhaltungen und allgemeinen Manipulationsverdächtigungen entgegen, dass es dank der Vielzahl von Plattformen heute “eine viel größere Vielfalt als vor zwanzig Jahren” gebe. Basis für die Nutzung seien die Hausregeln, doch habe sie auch nichts gegen eine übergeordnete Regulierung – sofern sie kohärent sei.
Gegen die Einschätzung von Arte-Deutschland-Geschäftsführer Markus Nievelstein, Youtube sei “das Fernsehen der Generation 20 plus”, wird Sabine Frank sicherlich nichts einwenden. Für die französischen Partner von Arte stehe diese Feststellung übrigens gar nicht infrage, sagte Nievelstein. Wichtig sei für die Sender, sich als Transmissionsriemen zu verstehen und die kuratorische Funktion wahrzunehmen.
Deutschlandradio-Intendant Stefan Raue sah bei eifrigem Bespielen von nicht-eigenen Plattformen durchaus nicht den großen Vorteil der Erweiterung der Möglichkeiten, sondern auch das Risiko der “Ressourcenverschwendung”. Die Sender müssten mithin ihre eigenen Stärken bewusst ausspielen.
Als zweiten Strang hatten die Veranstalter dem Kongress eher handwerklich-journalistische Fragestellungen eingezogen, konzentriert auf zwei Großthemen: einmal die Corona-Pandemie, welche in den Hochzeiten alle Medien stark beherrscht hat, und den Klimawandel, dessen Bedeutung in immer höherem Maße erkannt wird – bei einem großen Dilemma: dass die wahrscheinlich gravierenden globalen Folgen derzeit nur in Einzelerscheinungen zu erkennen sind, für ein großes Publikum also eher abstrakt erscheinen.
Am Beispiel der Pandemie ließ sich nachverfolgen, wie prekär das Verhältnis von Wissenschaft und Journalismus sein kann und wie sich die Formen der Berichterstattung und die Linien der Aufmerksamkeit verändern und verschieben können. Lothar Wieler, als Präsident des Robert-Koch-Instituts zeitweilig dauerpräsent in den Medien, gab aufschlussreiche Einblicke in seine Erfahrungen. Eine war für ihn wesentlich: dass Sachverhalte ignoriert werden, “wenn sie politisch nicht mehr opportun sind”.
Die Komplexität des Geschehens habe die Gefahr von “Überinformation und Desinformation” gefördert, sagte Wieler. Vielfach sei es nicht gelungen, die unterschiedlichen Bewertungen der jeweiligen Lage auch als Folge der prinzipiellen Offenheit der wissenschaftlichen Konstellationen zu vermitteln. “Kohärenz ist in pluralistischen Gesellschaften nicht möglich.” Mit der Folge eines tendenziellen Schwerpunktwechsels: vom Wissenschaftsjournalismus zum politischen Journalismus. Für Wieler ist die Schlussfolgerung aus seinen Erfahrungen eindeutig: “Vertrauen ist der Schlüssel für gute und effektive Kommunikation.”
Christian Hoffmann, Professor für Kommunikationsmanagement an der Universität Leipzig, zeichnete die Entwicklung der Formen und Schwerpunkte in der Pandemie-Berichterstattung nach, mit klaren Feststellungen: beispielsweise, dass die Personalisierung nach den ersten noch tastenden Expertenanfragen sich zu Auftritten in den Talkshows verdichtet habe (“der Ritterschlag”). Und dass Twitter auch hier zum zentralen Medium geworden sei, einfach, “weil alle dort sind”. Auch die eintretende “Themenermüdung” erwähnte er, was allerdings nichts an der wesentlichen Tatsache ändere, dass der Journalismus “entscheidend für die Wahrnehmung” sei. Er habe ein größeres Vertrauen in die öffentlich-rechtlichen Medien festgestellt, während gegenüber den sozialen Medien eine große Skepsis geherrscht habe.
Andreas Bönte (ARD-Alpha) sah durchaus einen Fortschritt gegenüber dem Medizin-Großthema, das Mitte der 80er Jahre in den Medien omnipräsent war: AIDS. Damals, so erinnert er sich, seien die Journalisten so panisch gewesen wie die Menschen selbst. Diese Erfahrung habe durchaus zur Angst vor erneuter Polarisierung führen können. Grundsätzlich übrigens könnten die Medien “ohne Gesichter, ohne Experten nicht agieren”.
Für Korinna Hennig, die als NDR-Wissenschaftsredakteurin in Kooperation mit dem Virologen Christian Drosten den sehr erfolgreichen Podcast “Coronavirus Update” auf die Beine gestellt hat, stellte eine Reaktion des Publikums heraus: “Gut, dass ihr die Fragezeichen benannt habt.” Ihr bisheriges Fazit: Lieber einmal mehr nachdenken, auch eine Leerstelle als Information anerkennen, vor allem aber auch: immer die möglichen Wirkungen bedenken.
Ob ihre Erfahrung “Wir zimmern das Schiff zusammen, während wir lossegeln” auch sonst gelten kann? Sibylle Anderl, im Feuilleton der “Frankfurter Allgemeinen Zeitung” für die Wissenschaft zuständig, hält der Improvisation eine klare Systematik beim Thema Klimawandel entgegen. Dies sei eine “Jahrhundertaufgabe”. Wichtig sei die Frage, welcher Zielgruppe welche Komplexität zuzumuten sei. Hilfreich seien interdisziplinäre Teams. Bei der Aufbereitung des Themas, bei dem manche Akteure starke Interessen vertreten, gelte es, eine “Balance zwischen Optimismus und Alarmismus” zu wahren.
Was wiederum auf einen Grundsatz verweist, der bei allem die Basis sein könnte und sollte: Stets die Relevanz und den Wert im Auge zu haben, den Vorgänge und Ereignisse für die Gesellschaft und damit für deren allgemeines Wohl haben.
Bei der Frage, wie und mit welchen Instrumenten sich Qualität in den Medien bestimmen lasse, zitierte die Mainzer Kommunikationswissenschaftlerin Birgit Stark zwar selbstironisch das Bonmot vom “Pudding an die Wand nageln”, doch plädierte sie leidenschaftlich für ein kontinuierliches Qualitätsmonitoring, das die Arbeit sinnvoll unterfüttern könne. Und sie schob ihr Credo gleich hinterher, um alle Anstrengungen beim begleitenden Diskurs zu rechtfertigen: “Länder mit einem hohen öffentlich-rechtlichen Medienniveau haben auch einen hohen Demokratie-Standard.”
Der Diskurs, in der Tat, ist anstrengend – dies war auch in Leipzig eine durchgängige Erfahrung. Die Verklammerung des Theorieteils mit der Frage, wie sich der stark dynamisierte gesellschaftsorientierte Gemeinwohlanspruch auf die journalistische Praxis auswirkt, führte zu einer Überfülle an Aspekten und Facetten. Was, und dies bedauerten viele aus dem Publikum, die Referate und Podien so einschnürte, dass für Fragen, Anmerkungen oder auch Kommentare keine Zeit blieb. Ein Kuriosum, denn zum allgemeinen Fazit, eingesammelt auf farbigen Karten, gehörten vor allem Forderungen wie Teilhabe, Offenheit für Impulse, Einbeziehen, Augenhöhe, Loslassen.
Doch das wird sicher bei einer dritten Public-Service-Konferenz zum praktischen Konsens gehören. Denn abgeschlossen ist natürlich gar nichts. Systemausrichtung muss immer, wie der Generaldirektor der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) Gilles Marchand betonte, “immer neu bestimmt werden”. Dass Leipzig mit dieser öffentlich-rechtlichen Selbstvergewisserung, zu der alle einschlägigen Medienhäuser aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie die Wissenschaft beitragen, derzeit ein Alleinstellungsmerkmal hat, steht für ein erfreuliches Engagement, ebenso wie die begleitenden drei “Leipziger Impulse” als Grundsatzpapiere.
Ex oriente lux, hieß es früher. Was an den Ursprung eines für die Gesellschaft ebenso wichtigen Wortes wie für jeden Einzelnen erinnert: Orientierung.
Alle Beiträge aus der Reihe “Das Beste aus epd Medien bei turi2” >>>
Zitat: Christian Drosten will “nicht Dr. Strange sein”.
 “Wenn ich in einer größeren Gruppe stehe, in der keiner eine Maske trägt, dann ziehe ich auch keine an. Ich will ja nicht Dr. Strange sein. Aber ich versuche immer, Rücksicht zu nehmen.”
“Wenn ich in einer größeren Gruppe stehe, in der keiner eine Maske trägt, dann ziehe ich auch keine an. Ich will ja nicht Dr. Strange sein. Aber ich versuche immer, Rücksicht zu nehmen.”Christian Drosten erzählt dem “Spiegel” im Interview, er habe ins Sachen Forschung “die Chance meines Lebens” ziehen lassen, um sich öffentlich zu engagieren.
spiegel.deHör-Tipp: Christian Drosten vermisst den Lerneffekt aus der Corona-Krise.
 Hör-Tipp: Virologe Christian Drosten konstatiert im “FAZ”-Podcast, dass Deutschland in der Forschungspolitik nicht die richtigen Rückschlüsse aus der Corona-Krise gezogen hat, auch weil der Ukraine-Krieg die Prioritäten ändert. Er befürchtet Einsparungen in der Forschung und einen langen Corona-Winter “mit vielen Arbeitsausfällen”.
Hör-Tipp: Virologe Christian Drosten konstatiert im “FAZ”-Podcast, dass Deutschland in der Forschungspolitik nicht die richtigen Rückschlüsse aus der Corona-Krise gezogen hat, auch weil der Ukraine-Krieg die Prioritäten ändert. Er befürchtet Einsparungen in der Forschung und einen langen Corona-Winter “mit vielen Arbeitsausfällen”.
faz.net (31-min-Audio)Klaus Stöhr rückt in den Corona-Sachverständigenrat auf.
 Klaus statt Christian: Der Virologe Klaus Stöhr rückt auf Vorschlag der CDU/CSU-Bundestagsfraktion in den Corona-Sachverständigenrat. Damit ersetzt er Christian Drosten, der Ende April seinen Rückzug aus dem Ausschuss bekannt gegeben hatte, der die Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung beurteilt.
Klaus statt Christian: Der Virologe Klaus Stöhr rückt auf Vorschlag der CDU/CSU-Bundestagsfraktion in den Corona-Sachverständigenrat. Damit ersetzt er Christian Drosten, der Ende April seinen Rückzug aus dem Ausschuss bekannt gegeben hatte, der die Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung beurteilt.
welt.deZitat: Christian Drosten antwortet auf Vorwurf des “autokratischen Wissenschaftsverständnis”.
 “Deutschland hatte zweifellos ein Problem beim ‘Public Health Messaging’, auch eins in der Wissenschaftskommunikation, aber ganz bestimmt keines in der Meinungsfreiheit.”
“Deutschland hatte zweifellos ein Problem beim ‘Public Health Messaging’, auch eins in der Wissenschaftskommunikation, aber ganz bestimmt keines in der Meinungsfreiheit.”Der Virologe Christian Drosten schreibt in der “FAZ”, er habe sich in der Vergangenheit wiederholt für einen “vielstimmigen wissenschaftlichen Diskurs” ausgesprochen. Der Beitrag Schluss mit dem Schnatter von René Schlott sei eine “gegenteilige, nachweislich falsche Unterstellung”.
faz.net (Paid)Basta: Schülerinnen wollen jetzt bei Tesla und in der Charité arbeiten.
 Reich und schnell: Schülerinnen wollen, wenn sie groß sind, am liebsten bei Polizei und Bundeswehr arbeiten, zeigt das aktuelle “Schülerbarometer”. Auf Platz 3 landet bei den Jungen in der Liste der Top-Arbeitgeber ganz neu der Autobauer Tesla. Die Schüler nehmen sich aber zum Glück nicht nur Pöbel-Unternehmer Elon Musk zum Vorbild, sondern auch Corona-Flüsterer Christian Drosten. Denn auch die Charité ploppt ebenfalls neu in der Liste auf.
Reich und schnell: Schülerinnen wollen, wenn sie groß sind, am liebsten bei Polizei und Bundeswehr arbeiten, zeigt das aktuelle “Schülerbarometer”. Auf Platz 3 landet bei den Jungen in der Liste der Top-Arbeitgeber ganz neu der Autobauer Tesla. Die Schüler nehmen sich aber zum Glück nicht nur Pöbel-Unternehmer Elon Musk zum Vorbild, sondern auch Corona-Flüsterer Christian Drosten. Denn auch die Charité ploppt ebenfalls neu in der Liste auf.
faz.netStreit um Täuschungsvorwurf: Christian Drosten setzt sich gegen Roland Wiesendanger durch.

Bogen überspannt: Der Physiker Roland Wiesendanger darf dem Virologen Christian Drosten keine gezielte Täuschung der Öffentlichkeit über den Ursprung des Coronavirus vorwerfen, bestätigt das Landgericht Hamburg eine einstweilige Verfügung vom 14. März. Dem Gericht fehlen “hinreichende Anknüpfungspunkte” für den Vorwurf; der Verweis auf einen offenen Brief von 27 Forscherinnen in der Fachzeitschrift “The Lancet” genüge nicht. Der “Cicero” hatte das Anfang Februar erschienene Interview mit den umstrittenen Aussagen von Wiesendanger nach einer Unterlassungserklärung offline genommen.Wiesendanger glaubt, Sars-CoV-2 sei durch einen Laborunfall entstanden. Drosten sagt, dass sowohl die Laborthese als auch die eines natürlichen Ursprungs nicht widerlegt oder bewiesen werden könne; vieles spreche aber für letztere Variante. Wiesendangers Anwalt hatte sich in der Verhandlung auf die Meinungsfreiheit berufen: Das in der Bevölkerung “meistbewegende Thema der letzten zwei Jahre” müsse in “maximaler Meinungsfreiheit” diskutiert werden. Wiesendanger hatte im Vorfeld angekündigt, bei einer Niederlage Berufung beim Hanseatischen Oberlandesgericht einzulegen.
sueddeutsche.de, spiegel.de, turi2.de (Background)Debatte: Karl Lauterbach verteidigt Drostens Rückzug aus Experten-Gremium.
 Dann halt ohne ihn: Der Virologe Christian Drosten hat sich aus dem Sachverständigen-Gremium zur Bewertung der Corona-Maßnahmen zurückgezogen, weil ihn Medien unter Druck gesetzt haben, sagt Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Die Unterstellung, Drosten habe nicht über die Maßnahmen urteilen wollen, weil er selbst an ihnen beteiligt war, sei “falsch und bösartig”. Der Virologe habe solche Vorwürfe “nicht nötig”.
Dann halt ohne ihn: Der Virologe Christian Drosten hat sich aus dem Sachverständigen-Gremium zur Bewertung der Corona-Maßnahmen zurückgezogen, weil ihn Medien unter Druck gesetzt haben, sagt Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Die Unterstellung, Drosten habe nicht über die Maßnahmen urteilen wollen, weil er selbst an ihnen beteiligt war, sei “falsch und bösartig”. Der Virologe habe solche Vorwürfe “nicht nötig”.
phoenix.de (30-Min-Video), turi2.de (Background)Christian Drosten steigt bei Evaluierung der Corona-Maßnahmen aus.
 Pandemie-Bilanz: Virologe Christian Drosten ist nicht mehr Teil des Ausschusses, der die Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung in Deutschland evaluiert, teilt Gesundheitsminister Karl Lauterbach bei Twitter mit. Das sei ein “schwerer Verlust”, schreibt Lauterbach, “weil niemand könnte es besser”. Mehrere Ausschuss-Mitglieder, darunter auch Drosten, sollen Zweifel geäußert haben, dass eine präzise Bewertung politischer Entscheidungen möglich sei, schreibt die “Welt”.
Pandemie-Bilanz: Virologe Christian Drosten ist nicht mehr Teil des Ausschusses, der die Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung in Deutschland evaluiert, teilt Gesundheitsminister Karl Lauterbach bei Twitter mit. Das sei ein “schwerer Verlust”, schreibt Lauterbach, “weil niemand könnte es besser”. Mehrere Ausschuss-Mitglieder, darunter auch Drosten, sollen Zweifel geäußert haben, dass eine präzise Bewertung politischer Entscheidungen möglich sei, schreibt die “Welt”.
twitter.com (Tweet Lauterbach), welt.deHör-Tipp: Drosten und Ciesek waren von Corona-Varianten überrascht.
 Hör-Tipp: Virologin Sandra Ciesek und ihr Kollege Christian Drosten zeigen sich in der letzten regulären Ausgabe des NDR-Podcasts Coronavirus Update überrascht davon, wie schnell das Virus neue Varianten entwickelt hat. Ciesek sagt, sie hatte in der Wahrnehmung ihrer Aussagen zum Teil das Gefühl, “man möchte auch missverstanden werden”. Drosten empfiehlt auch künftig “asiatische Höflichkeit” beim freiwilligen Maskentragen.
Hör-Tipp: Virologin Sandra Ciesek und ihr Kollege Christian Drosten zeigen sich in der letzten regulären Ausgabe des NDR-Podcasts Coronavirus Update überrascht davon, wie schnell das Virus neue Varianten entwickelt hat. Ciesek sagt, sie hatte in der Wahrnehmung ihrer Aussagen zum Teil das Gefühl, “man möchte auch missverstanden werden”. Drosten empfiehlt auch künftig “asiatische Höflichkeit” beim freiwilligen Maskentragen.
ndr.de (64-Min-Audio)Debatte: Sandro Schroeder nervt Personalisierung von Expertise in Podcasts.
 Schema P: Den redaktionellen Gast zum “alleinigen Dreh- und Angelpunkt” eines Podcasts zu machen, kann “durchaus schief gehen”, weil schnell verschwimme, “wer hier Absender und wer Gast ist”, schreibt Sandro Schroeder mit Blick auf personalisierte Corona- und Ukraine-Podcasts. Ihn stört, wie das “Coronavirus-Update” mit Christian Drosten “plötzlich für ein nachhaltiges und wiederholbares Podcast-Konzept gehalten wird”. Zwar gebe der Erfolg dieser Formate ihm unrecht, die “Fantasielosigkeit und Monokultur” nerve ihn trotzdem.
Schema P: Den redaktionellen Gast zum “alleinigen Dreh- und Angelpunkt” eines Podcasts zu machen, kann “durchaus schief gehen”, weil schnell verschwimme, “wer hier Absender und wer Gast ist”, schreibt Sandro Schroeder mit Blick auf personalisierte Corona- und Ukraine-Podcasts. Ihn stört, wie das “Coronavirus-Update” mit Christian Drosten “plötzlich für ein nachhaltiges und wiederholbares Podcast-Konzept gehalten wird”. Zwar gebe der Erfolg dieser Formate ihm unrecht, die “Fantasielosigkeit und Monokultur” nerve ihn trotzdem.
mailchi.mpZitat: Christian Drosten braucht keinen Podcast, um seine Meinung zu sagen.
 “Ich will natürlich im nächsten Winter nicht der sein, der nichts gesagt hat, als es brannte. Wenn sich große Probleme auftun, werde ich also wieder aktiver. Dafür brauche ich aber keinen Podcast.”
“Ich will natürlich im nächsten Winter nicht der sein, der nichts gesagt hat, als es brannte. Wenn sich große Probleme auftun, werde ich also wieder aktiver. Dafür brauche ich aber keinen Podcast.”Virologe Christian Drosten sagt im “Zeit”-Interview, dass er nach seinem Podcast-Ende lieber auf Interviews oder Twitter setzt, um seine Meinung zu Corona-Themen kundzutun. Der Politik traut er “ein konsequentes Handeln im Moment nicht mit Sicherheit zu”.
zeit.de (Paid)Drosten erzielt Teilerfolg gegen “Cicero”.
 Interview-Nachbeben: Virologe Christian Drosten hat im Prozess um ein “Cicero”-Interview mit Physiker Roland Wiesendanger einen Teilerfolg erzielt. Anfang Februar hat Wiesendanger Drosten vorgeworfen, “die Öffentlichkeit gezielt” über den Ursprung des Corona-Virus “getäuscht” zu haben. Diese Äußerung untersagt das Hamburger Landgericht. Zulässig seien die Aussagen, Drosten verbreite “Unwahrheiten” und fahre eine “Desinformationskampagne”. Direkt nach der Veröffentlichung des Interviews hat Drosten der “Süddeutschen Zeitung” gesagt, Wiesendangers Aussagen sind “haltlose Anschuldigen”.
Interview-Nachbeben: Virologe Christian Drosten hat im Prozess um ein “Cicero”-Interview mit Physiker Roland Wiesendanger einen Teilerfolg erzielt. Anfang Februar hat Wiesendanger Drosten vorgeworfen, “die Öffentlichkeit gezielt” über den Ursprung des Corona-Virus “getäuscht” zu haben. Diese Äußerung untersagt das Hamburger Landgericht. Zulässig seien die Aussagen, Drosten verbreite “Unwahrheiten” und fahre eine “Desinformationskampagne”. Direkt nach der Veröffentlichung des Interviews hat Drosten der “Süddeutschen Zeitung” gesagt, Wiesendangers Aussagen sind “haltlose Anschuldigen”. Wiesendanger wolle Widerspruch gegen das Urteil einlegen, berichtet die “SZ”. “Cicero” hat das Interview mittlerweile von der Webseite entfernt, an seiner Stelle befindet sich eine Stellungnahme des Chefredakteurs.
sueddeutsche.de, turi2.de (Background)“Cicero” nimmt Interview mit Roland Wiesendanger offline.

Vorübergehend versenkt: Der “Cicero” nimmt das am 2. Februar erschienene Interview mit Physiker Roland Wiesendanger offline. Wiesendanger hatte dem Virologen Christian Drosten in dem Gespräch u.a. vorgeworfen, er habe die Öffentlichkeit über den Ursprung des Corona-Virus getäuscht und “in die Irre geführt”. “Cicero” gibt an, einzelne Punkte derzeit “juristisch zu prüfen” sowie inhaltliche Ergebnisse “der Auseinandersetzung zwischen Christian Drosten und Roland Wiesendanger” abwarten zu wollen.Drosten hat sich gegen den Artikel erstmals juristisch gewehrt und sowohl von Wiesendanger als auch von “Cicero” eine Unterlassung gefordert. Das Magazin erklärt, das Interview sei “vorübergehend offline”, man werde “zu einem gegebenen Zeitpunkt reagieren”.
cicero.de, turi2.de (Background)Christian Drosten geht juristisch gegen “Cicero” und Roland Wiesendanger vor.
 Rote Linie überschritten: Der bisher nicht als besonders dünnhäutig aufgefallene Virologe Christian Drosten verlangt vom “Cicero” und dem Physiker Roland Wiesendanger eine Unterlassung und wehrt sich erstmals juristisch gegen einen Professoren-Kollegen. Wiesendanger hatte Drosten Anfang Februar in einem “Cicero”-Interview eine Corona-Verschwörung vorgeworfen und behauptet, er habe die Öffentlichkeit über den Ursprung des Corona-Virus gezielt getäuscht und “die ganze Medienwelt, die ganze Politik in die Irre” geführt.
Rote Linie überschritten: Der bisher nicht als besonders dünnhäutig aufgefallene Virologe Christian Drosten verlangt vom “Cicero” und dem Physiker Roland Wiesendanger eine Unterlassung und wehrt sich erstmals juristisch gegen einen Professoren-Kollegen. Wiesendanger hatte Drosten Anfang Februar in einem “Cicero”-Interview eine Corona-Verschwörung vorgeworfen und behauptet, er habe die Öffentlichkeit über den Ursprung des Corona-Virus gezielt getäuscht und “die ganze Medienwelt, die ganze Politik in die Irre” geführt.Drosten widerspricht dem Vorwurf vehement und versichert per eidesstattlicher Erklärung, dass ein menschgemachter Ursprung zum Corona-Ausbruch “aus mehreren wissenschaftlich-technischen Gründen unwahrscheinlich und in jedem Fall nicht belegbar” sei. Kern des Streits ist die Frage ob der Corona-Ausbruch eine Naturkatstrophe ist, auf einen Laborunfall zurückgeht oder sogar gezielt durch Menschen verbreitet wurde. Wiesendanger beruft sich bei seiner Kritik auf eine Telefonkonferenz mehrerer Virologen zu Beginn der Pandemie, bei der sich die Wissenschaftler, darunter auch Drosten, angeblich einheitlich auf eine Naturkatastrophe als Begründung für den Ausbruch verständigt hätten.
tagesschau.de, sueddeutsche.de


