
Nicht zum Lachen: Schauspieler und Regisseur Til Schweiger holt im Interview mit der "Zeit" zu seinem bisher ausführlichsten Rundumschlag gegen ihm gegenüber kritische Medien und andere Promis aus. Im Gespräch mit Cathrin Gilbert und Hanns-Bruno Kammertöns sagt er: "Ich habe schon lange meinen Frieden damit gemacht, dass ich von diesen Boulevardmedien als Clickbait genutzt werde." Konkret meint er "Bild", RTL und "besonders" "T-Online", die über Gerüchte berichtet hatten, dass Schweiger zum Alkohol-Entzug in einer Klinik sei. Dem "Spiegel" wirft er vor, mit seinem Artikel über Machtmissbrauch am Set seine Karriere zerstören zu wollen.
Auch an Kritik für Kulturstaatsministerin Claudia Roth spart Schweiger nicht: Die Politikerin habe bei Events immer seine Nähe gesucht. Als die Vorwürfe bekannt wurden, habe sie sich öffentlich darüber geäußert, ohne ihn vorher zu fragen, was an den Vorwürfen dran sei. Besonders harte Worte findet Schweiger für Jan Böhmermann und Oliver Pocher: "Die verachte ich, weil sie immer nur auf Kosten von anderen lachen." Schweiger hatte sich mal geschworen, Böhmermann "eine fette Schelle" zu verpassen, wenn er dem Satiriker mal begegnen würde. Er sei froh, bei einer Begegnung in einer Lufthansa-Lounge "nicht auf das Teufelchen in meinem Kopf" gehört zu haben.
Schweiger bescheinigt sich selbst "wirklich einen guten Humor", weil er über seine "eigene Blödheit" lachen könne.
"Zeit", 8/2024 S. 26, t-online.de, turi2.de (Background)
Foto: Picture alliance / dpa / Christian Charisius
 Hör-Tipp: Der Vorstandsvorsitzender des Bündnis gegen Cybermobbing Uwe Leest kritisiert im Deutschlandfunk die Medien-Berichterstattung über den selbst ernannten "Anzeigenhauptmeister" und zieht Parallelen zum Fall Drachenlord. Die überspitzte Darstellung von Niclas M. bei Spiegel TV z.B. als "Meister Petze" habe einen Medienhype ausgelöst und ihn zum Hass-Objekt im Netz gemacht, der bereits physische Angriffe nach sich ziehe. Die Medien hätte daran eine Mitschuld weil sie z.B. den vollen Namen und Wohnort des Falschpark-Anschwärzers nennen. Leest fordert deshalb ein Ende der Berichterstattung über den "Anzeigenhauptmeister".
Hör-Tipp: Der Vorstandsvorsitzender des Bündnis gegen Cybermobbing Uwe Leest kritisiert im Deutschlandfunk die Medien-Berichterstattung über den selbst ernannten "Anzeigenhauptmeister" und zieht Parallelen zum Fall Drachenlord. Die überspitzte Darstellung von Niclas M. bei Spiegel TV z.B. als "Meister Petze" habe einen Medienhype ausgelöst und ihn zum Hass-Objekt im Netz gemacht, der bereits physische Angriffe nach sich ziehe. Die Medien hätte daran eine Mitschuld weil sie z.B. den vollen Namen und Wohnort des Falschpark-Anschwärzers nennen. Leest fordert deshalb ein Ende der Berichterstattung über den "Anzeigenhauptmeister".
deutschlandfunk.de (5-min-Audio)
Zitat: Medienethiker Alexander Filipović ordnet den medialen Umgang mit Alexandra Föderl-Schmid ein.
 "Eigentlich müssten wir uns alle schämen und die Klappe halten, weil wir natürlich Teil dieser fatalen Kommunikationsdynamik sind, die entsteht und die einen Menschen in die Verzweiflung drängen kann."
"Eigentlich müssten wir uns alle schämen und die Klappe halten, weil wir natürlich Teil dieser fatalen Kommunikationsdynamik sind, die entsteht und die einen Menschen in die Verzweiflung drängen kann."
Medienethiker Alexander Filipović findet es im Interview mit der KNA "unwürdig", dass ausgerechnet "Nius" von Julian Reichelt die Plagiatsjagd auf "Süddeutsche"-Vize Alexandra Föderl-Schmid finanziert hat, weil es dem Portal "wohl nicht um wissenschaftliche Qualität gehen dürfte". Nach dem Bekanntwerden von journalistischen Fehlern Föderl-Schmids ihre Doktor-Arbeit zu prüfen, findet er "moralisch fragwürdig".
kress.de
 Fehlsteuerung: Das Funk-Reportage-Format STRG_F hat "ein riesengroßes Glaubwürdigkeitsproblem", räumt Funk-Content-Leiter Stefan Spiegel bei Deutschlandfunk Kultur ein. "Eine sehr große Community auf YouTube vertraut dem Format nicht mehr", sagt er. Grund ist ein Video von YouTuber Rezo, der "STRG_F" wiederholt Framing und Falschbehauptungen vorwirft. Um das Vertrauen wiederherzustellen, müsse man "unbedingt was tun", kündigt Spiegel an. Es gehe um eine "sehr offene Fehlerkultur" und "so groß wie mögliche Transparenz".
Fehlsteuerung: Das Funk-Reportage-Format STRG_F hat "ein riesengroßes Glaubwürdigkeitsproblem", räumt Funk-Content-Leiter Stefan Spiegel bei Deutschlandfunk Kultur ein. "Eine sehr große Community auf YouTube vertraut dem Format nicht mehr", sagt er. Grund ist ein Video von YouTuber Rezo, der "STRG_F" wiederholt Framing und Falschbehauptungen vorwirft. Um das Vertrauen wiederherzustellen, müsse man "unbedingt was tun", kündigt Spiegel an. Es gehe um eine "sehr offene Fehlerkultur" und "so groß wie mögliche Transparenz".
deutschlandfunkkultur.de (12-Min-Audio, O-Ton-Spiegel ab 10:36), faz.net (€), youtube.com (67-Min-Video von Rezo)

Zum Raabport: Die CDU-Fraktion im Landtag von Rheinland-Pfalz fordert den Rücktritt von Medien-Staatssekretärin Heike Raab, die auch Koordinatorin der Rundfunkkommission der Länder ist. Die SPD-Politikerin hatte sich im Mai auf Briefpapier der Landesregierung über eine SWR-Sendung beschwert. Ein SWR-Journalist hatte in der Sendung den früheren Innenminister Roger Lewentz für die Toten der Ahrtal-Flutkatastrophe verantwortlich gemacht und moniert, dass er weiterhin SPD-Landeschef ist. Raab würde versuchen, eine "unliebsame Berichterstattung zu beeinflussen und Druck aus einer Machtposition heraus auszuüben". Die Landespressekonferenz Rheinland-Pfalz sieht in dem Schreiben einen "Einschüchterungsversuch". Der SWR dagegen findet "Programmkritik von außen" nicht ungewöhnlich. Raab selbst sagt, inhaltlich stehe sie weiterhin zu ihrer Kritik, die Unabhängigkeit der Medien sei jedoch "ein hohes Gut". Die CDU will den Fall am Donnerstag im Landtag thematisieren, auch der Landesrundfunkrat des SWR werde sich damit befassen.
dwdl.de, evangelische-zeitung.de, swr.de, merkur.de, faz.net (€)
Foto: Staatskanzlei RLP/ Unger
 Tatenlos? Der Antiziganismus-Beauftragte der Bundesregierung, Mehmet Daimagüler, kritisiert in einem Brief an WDR-Intendant Tom Buhrow fehlenden Widerspruch gegen eine antiziganistische Äußerung im "Kölner Treff". Schauspieler Ben Becker hatte gesagt: "Was sagte man früher: Man muss, wie die Zigeuner, hinter die Büsche scheißen …". Moderator Micky Beisenherz und seine Kollegin Susan Link hätten bestätigt, dass man das früher so gesagt habe. Eine Missbilligung der "rassistischen Fremdbezeichnung für Sinti und Roma" sei jedoch ausgeblieben, beklagt Daimagüler. Der WDR sagt der "Mopo": In der Nachbetrachtung hätte der Widerspruch "noch deutlicher ausfallen sollen".
Tatenlos? Der Antiziganismus-Beauftragte der Bundesregierung, Mehmet Daimagüler, kritisiert in einem Brief an WDR-Intendant Tom Buhrow fehlenden Widerspruch gegen eine antiziganistische Äußerung im "Kölner Treff". Schauspieler Ben Becker hatte gesagt: "Was sagte man früher: Man muss, wie die Zigeuner, hinter die Büsche scheißen …". Moderator Micky Beisenherz und seine Kollegin Susan Link hätten bestätigt, dass man das früher so gesagt habe. Eine Missbilligung der "rassistischen Fremdbezeichnung für Sinti und Roma" sei jedoch ausgeblieben, beklagt Daimagüler. Der WDR sagt der "Mopo": In der Nachbetrachtung hätte der Widerspruch "noch deutlicher ausfallen sollen".
mopo.de, tagesspiegel.de
 Jetzt ist auch mal gut! Die Sprecherin der Stadt Dresden, Barbara Knifka, reagiert mit einem patzigen Kommentar auf eine "Investigativoffensive" der "Morgenpost Sachsen" und des Sachsenfernsehens zur Vergabe einer Party für 18-Jährige im Dresdner Rathaus. Dabei würde "Altes nochmal aufgewärmt und klare Fakten einfach ignoriert". Von den mittlerweile 14 Medienanfragen und 21 Stadtratsanfragen zum Thema sei die Pressestelle "langsam tierisch" genervt. Flurfunk-Dresden-Herausgeber Peter Stawowy hält Knifkas Polemik für "völlig unangemessen".
Jetzt ist auch mal gut! Die Sprecherin der Stadt Dresden, Barbara Knifka, reagiert mit einem patzigen Kommentar auf eine "Investigativoffensive" der "Morgenpost Sachsen" und des Sachsenfernsehens zur Vergabe einer Party für 18-Jährige im Dresdner Rathaus. Dabei würde "Altes nochmal aufgewärmt und klare Fakten einfach ignoriert". Von den mittlerweile 14 Medienanfragen und 21 Stadtratsanfragen zum Thema sei die Pressestelle "langsam tierisch" genervt. Flurfunk-Dresden-Herausgeber Peter Stawowy hält Knifkas Polemik für "völlig unangemessen".
flurfunk-dresden.de, sachsen-fernsehen.de (3-Min-Video), tag24.de (Background)

Relativierende Berichterstattung? Der "FAZ"-Autor Nikolai Klimeniouk wirft dem "Spiegel" vor, durch seine "israelkritische Berichterstattung" zur Ausbreitung von Antisemitismus in Deutschland beizutragen. Im Archiv des Blattes fänden sich zahlreiche Artikel, in denen Täter-Opfer-Umkehr stattfinde, so Klimeniouk, der selbst Jude ist.
Der aktuelle "Spiegel"-Titel "Judenhass in Deutschland" sei "Panikmache" und "heuchlerisch". Der "Spiegel" mache mit seinem Cover "die Angst Einzelner zu einem gesamtgesellschaftlichen Phänomen" und wälze die Angst der Nation vor Antisemitismus und Unruhen in Deutschland auf jüdische Menschen ab. Er ermutige die Täter und entmutige die Juden von jedem Zeitungskiosk in Deutschland aus. (Bild: Spiegel / Nikolai Klimeniouk / Fotomontage: turi2)
faz.net
 Nuhr eine Meinung? Comedian Dieter Nuhr sorgt sich im "Zeit Magazin" um die Meinungsfreiheit in Deutschland. "Wer mal die vermeintlich Falschen kritisiert, muss mit Folgen rechnen, die eben nicht ohne Weiteres auszuhalten sind", sagt er. Es gebe Menschen, "die werden mundtot gemacht". Das reiche "bis zur Vernichtung von Existenzen". Dem Vorwurf, er mache rechte Comedy weist Nuhr von sich: "Dass jegliche Auseinandersetzung" mit der Klimapolitik der Regierung "schon als rechts diffamiert wird", zerstöre "die demokratische Gesellschaft in ihren Grundfesten".
Nuhr eine Meinung? Comedian Dieter Nuhr sorgt sich im "Zeit Magazin" um die Meinungsfreiheit in Deutschland. "Wer mal die vermeintlich Falschen kritisiert, muss mit Folgen rechnen, die eben nicht ohne Weiteres auszuhalten sind", sagt er. Es gebe Menschen, "die werden mundtot gemacht". Das reiche "bis zur Vernichtung von Existenzen". Dem Vorwurf, er mache rechte Comedy weist Nuhr von sich: "Dass jegliche Auseinandersetzung" mit der Klimapolitik der Regierung "schon als rechts diffamiert wird", zerstöre "die demokratische Gesellschaft in ihren Grundfesten".
t-online.de
 "Bei Lindemann habe ich eine volle Kriegskasse, was bedeutet, dass wir uns vom 'Spiegel' nicht einschüchtern lassen müssen oder von den Medien nach dem Motto: bloss nicht zu viel Geld ausgeben."
"Bei Lindemann habe ich eine volle Kriegskasse, was bedeutet, dass wir uns vom 'Spiegel' nicht einschüchtern lassen müssen oder von den Medien nach dem Motto: bloss nicht zu viel Geld ausgeben."
Simon Bergmann, Anwalt von Rammstein-Sänger Till Lindemann, kritisiert m Interview mit der "NZZ" die #MeToo-Berichterstattung deutscher Medien. Als problematisch empfindet Bergmann u.a. die Praxis, Frauen, die anonym bleiben wollen, in verschiedenen Medien "Phantasienamen" zu geben: "Und dann stellen wir im Prozess fest, dass es sich bei 'Kaya R.' und 'Anna' um dieselbe Frau handelt. Die Leute aber denken: So viele Opfer? Was für ein Monster!"
nzz.ch
 Keine Wagenknechte: Linken-Abgängerin Sahra Wagenknecht übt vor der Bundespressekonferenz im Rahmen der Ankündigung ihrer Parteigründung Medienkritik. Die Politikerin wirft den Hauptstadtmedien Kampagnen vor, u.a. indem sie in die Nähe des russischen Machthabers Putin gerückt werde. Dem widerspricht sie und fordert die Medien auf: "Gehen Sie nicht den billigen Weg, uns Dinge zu unterstellen, die wir gar nicht vertreten." DJV-Chef Frank Überall springt für die Medien in die Bresche: Sie würden seit Jahren " ausführlich und vielseitig" über Wagenknecht berichten. Er fordert die Politikerin auf, mit Fakten und Argumenten zu überzeugen, statt mit Vorwürfen. "Wir Journalisten lassen uns nicht als Steigbügelhalter bei einer möglichen Parteigründung von Sarah Wagenknecht benutzen."
Keine Wagenknechte: Linken-Abgängerin Sahra Wagenknecht übt vor der Bundespressekonferenz im Rahmen der Ankündigung ihrer Parteigründung Medienkritik. Die Politikerin wirft den Hauptstadtmedien Kampagnen vor, u.a. indem sie in die Nähe des russischen Machthabers Putin gerückt werde. Dem widerspricht sie und fordert die Medien auf: "Gehen Sie nicht den billigen Weg, uns Dinge zu unterstellen, die wir gar nicht vertreten." DJV-Chef Frank Überall springt für die Medien in die Bresche: Sie würden seit Jahren " ausführlich und vielseitig" über Wagenknecht berichten. Er fordert die Politikerin auf, mit Fakten und Argumenten zu überzeugen, statt mit Vorwürfen. "Wir Journalisten lassen uns nicht als Steigbügelhalter bei einer möglichen Parteigründung von Sarah Wagenknecht benutzen."
n-tv.de (10-Min-Video), djv.de
 Lese-Tipp: Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen träumt im "Tagesspiegel" von sozialen Medien ohne klassische Werbefinanzierung und strikter Machtbegrenzung Einzelner. Seiner Ansicht nach, wäre Europa ohne X besser dran. Er empfiehlt der EU im Machtkampf mit Elon Musk Ausdauer und Haltung. Es gehe schließlich um die Frage, "wem die Öffentlichkeit eigentlich gehört" und "wer das Kommunikationsklima bestimmt". Elon Musk agiere zunehmend als "missionarischer Kulturkämpfer", der eine "Öffentlichkeit der libertären Zügellosigkeit" schaffen wolle.
Lese-Tipp: Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen träumt im "Tagesspiegel" von sozialen Medien ohne klassische Werbefinanzierung und strikter Machtbegrenzung Einzelner. Seiner Ansicht nach, wäre Europa ohne X besser dran. Er empfiehlt der EU im Machtkampf mit Elon Musk Ausdauer und Haltung. Es gehe schließlich um die Frage, "wem die Öffentlichkeit eigentlich gehört" und "wer das Kommunikationsklima bestimmt". Elon Musk agiere zunehmend als "missionarischer Kulturkämpfer", der eine "Öffentlichkeit der libertären Zügellosigkeit" schaffen wolle.
tagesspiegel.de
“Es muss immer krasser werden, damit die Menschen hinschauen” – Paul Ronzheimer über Krieg und Frieden.

Graustufen: “Bild”-Reporter Paul Ronzheimer bringt den Krieg auf unsere Smartphone-Screens und reist dafür um die Welt. Mit turi2-Chefredakteur Markus Trantow und für die turi2 edition #22 macht er Halt in Köln. Vor dem Dom sprechen sie über Frieden, Gott, Medien-Monster – und die Frage, ob man als Journalist eine Seite wählen muss. “Wir müssen aufpassen, dass wir nicht jede kritische Äußerung als Propaganda abstempeln,” sagt Ronzheimer mit Blick auf die mediale Repräsentation von Menschen, die Linke oder AfD wählen. Die sozialen Medien findet er so radikalisiert, “dass wir womöglich Gefahr laufen, diese Menschen komplett zu verlieren”.
weiterlesen >>>, turi2.de/edition22, issuu.com (Interview im kostenlosen E-Paper lesen)
 Lese-Tipp: "Die wohl wichtigste journalistische Aufgabe ist es, die Folgen einer Normalisierung des Rechtsextremismus zu zeigen", schreibt Michael Kraske im "Journalist" über den Umgang von Redaktionen mit der AfD. Zu oft würden Medien "unbeirrt am Label 'Protestwähler'" festhalten, obwohl empirische Befunde dagegensprächen. Jan Hollitzer, Chefredakteur der "Thüringer Allgemeinen", möchte jeden Eindruck von Bevormundung vermeiden: Er beobachte, dass bei seiner Leserschaft "durch eine übermäßige Benennung der AfD als rechtsextreme Partei Jetzt-Erst-Recht-Reaktionen eintreten".
Lese-Tipp: "Die wohl wichtigste journalistische Aufgabe ist es, die Folgen einer Normalisierung des Rechtsextremismus zu zeigen", schreibt Michael Kraske im "Journalist" über den Umgang von Redaktionen mit der AfD. Zu oft würden Medien "unbeirrt am Label 'Protestwähler'" festhalten, obwohl empirische Befunde dagegensprächen. Jan Hollitzer, Chefredakteur der "Thüringer Allgemeinen", möchte jeden Eindruck von Bevormundung vermeiden: Er beobachte, dass bei seiner Leserschaft "durch eine übermäßige Benennung der AfD als rechtsextreme Partei Jetzt-Erst-Recht-Reaktionen eintreten".
journalist.de
“Wie eimerweise Popcornfressen” – Oliver Kalkofe über TV-Liebe und TikTok-Hass.
Unter Medienjunkies: “Ich habe mich schon als Kind zu allem hingezogen gefühlt, was auf Bildschirmen geschieht – egal ob Fernseher oder Kinoleinwand”, sagt TV-Kritiker und Satiriker Oliver Kalkofe im turi2 Jobs-Podcast. Mit Chefredakteur Markus Trantow spricht Kalkofe über seine Karriere, die beim Radio begann und ihn inzwischen regelmäßig in politische Talkshows wie “Maischberger” führt. Er erklärt, dass er das Kultformat “Kalkofes Mattscheibe” durchaus wiederbeleben würde und dass er inzwischen von Netflix enttäuscht ist. Auch für die Influencer-Ökonomie hat der TV-Terminator wenig schmeichelhafte Kommentare übrig: Dass es gelinge, junge Menschen so zu täuschen, dass sie “Influencer, die ihnen nur Scheiße verkaufen”, mögen und ihnen folgen, findet Kalkofe “gruselig”. Er erinnert sich an die “Influencer” seiner Jugend – Werbefiguren wir “Herr Kaiser” von der Hamburg Mannheimer oder “Klementine” von Ariel. “Wir wären nie auf die Idee gekommen, denen eine Postkarte zu schicken: ‘Klementine, ich finde dich so süß. Deine Latzhose ist so geil.’” Dieser Podcast ist Teil der Screen-Wochen bei turi2. Bis 8. Oktober beschäftigen wir uns auf turi2.de mit Entwicklungen und Trends für Bildschirme – von der Smartwatch bis zum großen Werbescreen.
Weiterlesen >>>, turi2.tv (61-Min-Podcast auf YouTube), spotify.com, podcast.apple.com, deezer.com, plus.rtl.de
 "Wenn eine Form dazu einlädt, Meinungen oder Aussagen zu verbreiten, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen Überzeugungen der zitierten Person entsprechen, eine Form, in der die Begrenzung dazu führt, dass Inhalte ungenau oder verzerrt wiedergegeben werden, eine Form, die keinen Raum für Kontext geben kann, was zu Missverständnissen mit Ansage führt, dann scheint etwas mit der Form kaputt."
"Wenn eine Form dazu einlädt, Meinungen oder Aussagen zu verbreiten, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen Überzeugungen der zitierten Person entsprechen, eine Form, in der die Begrenzung dazu führt, dass Inhalte ungenau oder verzerrt wiedergegeben werden, eine Form, die keinen Raum für Kontext geben kann, was zu Missverständnissen mit Ansage führt, dann scheint etwas mit der Form kaputt."
Autorin Samira El Ouassil kritisiert bei Übermedien, dass Zitatkacheln für Social Media Aussagen oft aus dem Kontext reißen und die Zitierten dafür angefeindet werden. Sie appelliert an Redaktionen, bei der Auswahl mehr Feingefühl zu beweisen oder das Kachel-Zitat abzustimmen.
uebermedien.de (€)
 Glaubensbekenntnis: Welt-Chefredakteur Ulf Poschardt wirft den Medien im Interview mit dem christlichen Online-Magazin Corrigenda.online vor, bei Familie und Abtreibung falsche Werte zu vertreten. "Wir haben verlernt, was das für ein Glück ist, was uns Kinder bedeuten sollten", sagt Poschardt. In Berichten über Abtreibung lese er bisweilen einen "triumphalen Unterton". Poschardt spricht auch über seinen Glauben, der von seiner protestantischen Erziehung und seinem jesuitischen Studium geprägt sei.
Glaubensbekenntnis: Welt-Chefredakteur Ulf Poschardt wirft den Medien im Interview mit dem christlichen Online-Magazin Corrigenda.online vor, bei Familie und Abtreibung falsche Werte zu vertreten. "Wir haben verlernt, was das für ein Glück ist, was uns Kinder bedeuten sollten", sagt Poschardt. In Berichten über Abtreibung lese er bisweilen einen "triumphalen Unterton". Poschardt spricht auch über seinen Glauben, der von seiner protestantischen Erziehung und seinem jesuitischen Studium geprägt sei.
corrigenda.online

Döpfners Depesche: Springer-Chef Mathias Döpfner fühlt sich berufen, bei "Bild" die Aiwanger-Affäre und die Berichterstattung darüber persönlich zu kommentieren. Er wirft "einigen sogenannten Leitmedien" – und meint damit wohl die "Süddeutsche Zeitung" – "politische Einseitigkeit, Vorverurteilung und moralische Doppelstandards" vor. Daher würden sich "noch mehr Menschen" von diesen abwenden. Die Freien Wähler gewinnen an Zuspruch, eine Koalition der CSU mit den Grünen sei "in weite Ferne gerückt". Döpfner sieht es zudem kritisch, dass "widerliche antisemitische Parolen" in Deutschland als "'Jugendsünde' verbucht" würden. Was auch immer "die Hintermänner und Hinterfrauen der Affäre Aiwanger genau erreichen wollten", sei "wahrscheinlich das Gegenteil des vorläufigen Ergebnisses". Für Döpfner ein "Totalschaden".
bild.de
 Hör-Tipp: TV-Kritikerin Anja Rützel wünscht sich ein Reality-TV-Format mit Menschen aus dem bürgerlichen Milieu. Ihr "absoluter Traum" wäre eine Sendung wie "The Real Housewives of Prenzlauer Berg", sagt sie im Podcast "Läuft" von epd Medien. Rützel fände es spannend, Menschen zu beobachten, die auf Instagram eine "geschönte Bürgerlichkeitsfassade, dieses Neobiedermeier" zeigen und dann durch das TV-Format unter Druck gerieten.
Hör-Tipp: TV-Kritikerin Anja Rützel wünscht sich ein Reality-TV-Format mit Menschen aus dem bürgerlichen Milieu. Ihr "absoluter Traum" wäre eine Sendung wie "The Real Housewives of Prenzlauer Berg", sagt sie im Podcast "Läuft" von epd Medien. Rützel fände es spannend, Menschen zu beobachten, die auf Instagram eine "geschönte Bürgerlichkeitsfassade, dieses Neobiedermeier" zeigen und dann durch das TV-Format unter Druck gerieten.
laeuft-programmschau.podigee.io (26-Min-Audio)
 Friedrich der Mahner: CDU-Chef Friedrich Merz nutzt seinen Bierzelt-Auftritt beim Gillamoss-Volksfest in Niederbayern für Medienschelte im Fall Aiwanger. "Überlegen Sie sich gut, welche Verantwortung Sie auch haben in Deutschland", appelliert er. Merz erwarte, dass Medien "ein Spiegelbild der Gesellschaft sind" und "ein breites Meinungsspektrum zum Ausdruck kommt", insbesondere bei "denjenigen, die aus Gebühren finanziert werden".
Friedrich der Mahner: CDU-Chef Friedrich Merz nutzt seinen Bierzelt-Auftritt beim Gillamoss-Volksfest in Niederbayern für Medienschelte im Fall Aiwanger. "Überlegen Sie sich gut, welche Verantwortung Sie auch haben in Deutschland", appelliert er. Merz erwarte, dass Medien "ein Spiegelbild der Gesellschaft sind" und "ein breites Meinungsspektrum zum Ausdruck kommt", insbesondere bei "denjenigen, die aus Gebühren finanziert werden".
faz.net

Talky Luke: Comedian Luke Mockridge bezieht zwei Jahre nach den Missbrauchs-Vorwürfen seiner Ex-Freundin Ines Anioli ausführlich Position zu den Geschehnissen um seine Person. Im Podcast "Hätte ich das mal früher gewusst" von Joyce Ilg und Chris Halb 12 erzählt Mockridge, dass er "zwangseingewiesen" wurde, um in einer Klinik drei Monate in einem "geschützten Raum" zu sein, abgeschottet von Hassbotschaften im Netz. Angebote für Interviews oder Buchdeals habe er bisher alle abgelehnt, weil er Privates und Öffentliches voneinander trennen will. "Ich möchte nicht dafür bekannt sein, mit wem ich schlafe", sagt Mockridge und findet es schade, dass ihm dies fast wie ein Schuldeingeständnis ausgelegt worden sei. Sein großes Learning: "Das, was online passiert, ist nicht die Realität."
youtube.com (61-Min-Video), podigee.io (61-Min-Audio) via t-online.de, rtl.de, tag24.de
 Kritikwürdig: Der Deutsche Presserat hat bis Dienstagmittag sechs Beschwerden über die Berichterstattung der "Süddeutschen Zeitung" im Fall Aiwanger erhalten, teilt das Kontrollgremium auf Anfrage von epd Medien mit. Die Beschwerdeführenden kritisierten demnach sehr allgemein ihr Missfallen an der Form der Verdachtsberichtserstattung. Einige bezweifelten auch, dass es überhaupt ein öffentliches Interesse an den Vorwürfen gebe.
Kritikwürdig: Der Deutsche Presserat hat bis Dienstagmittag sechs Beschwerden über die Berichterstattung der "Süddeutschen Zeitung" im Fall Aiwanger erhalten, teilt das Kontrollgremium auf Anfrage von epd Medien mit. Die Beschwerdeführenden kritisierten demnach sehr allgemein ihr Missfallen an der Form der Verdachtsberichtserstattung. Einige bezweifelten auch, dass es überhaupt ein öffentliches Interesse an den Vorwürfen gebe.
sonntagsblatt.de
 Déjà-vu: Das Aufmacher-Interview mit Ferdinand von Schirach im aktuellen "stern" kommt Stefan Niggemeier bekannt vor. Vor fast genau einem Jahr hat auch das "SZ-Magazin" ein großes Interview mit dem Schriftsteller geführt und ebenfalls mit Schwarz-Weiß-Foto auf den Titel gebracht. Bei Übermedien vergleicht Niggemeier Passagen, in denen von Schirach fast wortgleich antwortet. In anderen Fällen bauen die "stern"-Interviewer mit Bezug aufs "SZ-Magazin" eine Brücke zur gewünschten Antwort.
Déjà-vu: Das Aufmacher-Interview mit Ferdinand von Schirach im aktuellen "stern" kommt Stefan Niggemeier bekannt vor. Vor fast genau einem Jahr hat auch das "SZ-Magazin" ein großes Interview mit dem Schriftsteller geführt und ebenfalls mit Schwarz-Weiß-Foto auf den Titel gebracht. Bei Übermedien vergleicht Niggemeier Passagen, in denen von Schirach fast wortgleich antwortet. In anderen Fällen bauen die "stern"-Interviewer mit Bezug aufs "SZ-Magazin" eine Brücke zur gewünschten Antwort.
uebermedien.de, stern.de (€), sz-magazin.sueddeutsche.de (€) turi2.de (Background)

Nach dem Wind drehen: Die mediale Berichterstattung über Windkraft, Naturschutz und Energiepolitik ist oft "unterschwellig durchzogen" von "soziokulturellen Mentalitäten sowie tief verwurzelten Denkmustern und Moralvorstellungen", sagt die Studie Vom Winde verdreht? der Otto Brenner Stiftung. Faktentreue und die adäquate Wiedergabe des wissenschaftlichen Standes stünden hinter Emotionalisierungen zurück. Die Kulturwissenschaftlerin Georgiana Banita von der Uni Bamberg hat für die Studie ausgewählte skeptische und befürwortende Berichte aus "FAZ", "Welt", "Spiegel" und "Süddeutscher Zeitung" untersucht und dabei eine deutliche Lagerbildung festgestellt. "Was dabei auf der Strecke bleibt, ist die eigene Widerspruchs- und Debattenkultur", sagt Banita. Die untersuchten Artikel bemühten sich kaum, die Gegenseite zu Wort kommen zu lassen oder ihre Leserinnen vor eine Wahl zu stellen.
otto-brenner-stiftung.de (Zusammenfassung), otto-brenner-stiftung.de (Detail-Infos)
 Könnte teuer werden: Jurist und Schriftsteller Ferdinand von Schirach regt im "stern"-Interview eine Strafzahlung für Medien an, sollte eine unzutreffende Berichterstattung dazu führen, dass das Ansehen eines Betroffenen erheblich geschädigt wird. Berichte über MeToo-Fälle entwickelten sich in sozialen Medien "zum Horror", komplexe Sachverhalte würden "auf einen einzigen Satz reduziert". Die Gefahr einer Strafzahlung würde Recherchen "ein ganz anderes Gewicht" verleihen, ist von Schirach überzeugt, weil das Publikum wüsste, was für Medien "auf dem Spiel steht".
Könnte teuer werden: Jurist und Schriftsteller Ferdinand von Schirach regt im "stern"-Interview eine Strafzahlung für Medien an, sollte eine unzutreffende Berichterstattung dazu führen, dass das Ansehen eines Betroffenen erheblich geschädigt wird. Berichte über MeToo-Fälle entwickelten sich in sozialen Medien "zum Horror", komplexe Sachverhalte würden "auf einen einzigen Satz reduziert". Die Gefahr einer Strafzahlung würde Recherchen "ein ganz anderes Gewicht" verleihen, ist von Schirach überzeugt, weil das Publikum wüsste, was für Medien "auf dem Spiel steht".
stern.de (€), tagesspiegel.de (Zusammenfassung)
 Video-Tipp: Das Funk-Format "offen un' ehrlich" wirft Influencer Finn Lorenzen, bekannt als Finnel, und seinem Geschäftspartner Andre Braun alias Mandre vor, Videos, in denen sie scheinbar zufälligen Passanten Geschenke machen, zu inszenieren. So sei etwa ein Empfänger eines Geschenks ein Mitarbeiter der gemeinsamen Firma Virral. Eine Influencerin berichtet, Finnel und Mandre hätten bei einem Dreh darauf bestanden, dass ihr Freund den zufällig Beschenkten spielt.
Video-Tipp: Das Funk-Format "offen un' ehrlich" wirft Influencer Finn Lorenzen, bekannt als Finnel, und seinem Geschäftspartner Andre Braun alias Mandre vor, Videos, in denen sie scheinbar zufälligen Passanten Geschenke machen, zu inszenieren. So sei etwa ein Empfänger eines Geschenks ein Mitarbeiter der gemeinsamen Firma Virral. Eine Influencerin berichtet, Finnel und Mandre hätten bei einem Dreh darauf bestanden, dass ihr Freund den zufällig Beschenkten spielt.
youtube.com (13-Min-Video), presse.funk.net
 Muss gehen: RTL News trennt sich mit sofortiger Wirkung von dem freien Moderator und Reporter Maurice Gajda. Er hatte für einen Beitrag in "Explosiv Weekend" einen gelöschten Tweet von Ex-AfD-Chefin Frauke Petry nachgebaut, dessen Existenz Petry bestreitet. Weitreichende Prüfungen hätten bisher keinerlei Hinweis darauf gefunden, dass es den Tweet "so jemals gegeben hat", teilt RTL mit. Gajdas Handeln offenbare "zahlreiche eklatante Verstöße gegen die journalistische Sorgfaltspflicht".
Muss gehen: RTL News trennt sich mit sofortiger Wirkung von dem freien Moderator und Reporter Maurice Gajda. Er hatte für einen Beitrag in "Explosiv Weekend" einen gelöschten Tweet von Ex-AfD-Chefin Frauke Petry nachgebaut, dessen Existenz Petry bestreitet. Weitreichende Prüfungen hätten bisher keinerlei Hinweis darauf gefunden, dass es den Tweet "so jemals gegeben hat", teilt RTL mit. Gajdas Handeln offenbare "zahlreiche eklatante Verstöße gegen die journalistische Sorgfaltspflicht".
dwdl.de, media.rtl.com, turi2.de (Background)
Korrekturhinweis: In einer vorigen Fassung der Meldung hatten wir den Beitrag von Maurice Gajda fälschlicherweise "Exclusiv Weekend" zugeschrieben. Richtig ist, dass er bei "Explosiv Weekend" lief. Wir haben die Meldung entsprechend angepasst.

Kaputter Kompass? Der "Spiegel" stellt wie erwartet die journalistische Unabhängigkeit des Medien-Startups The Pioneer von Gabor Steingart infrage. Pioneer diene sich "gegen Geld Unternehmen, Verbänden und Lobby-Gruppen an, ohne dies den Leserinnen und Lesern transparent zu machen". Das Magazin beruft sich auf interne Unterlagen zur Vermietung des Medienschiffs Pioneer One. Demnach habe jeder der 25 Kunden im Jahr 2021 im Schnitt rund 44.000 Euro in die Unternehmenskasse gebracht. 2022 lägen die Einnahmen laut einer Schätzung bei knapp 1,9 Mio Euro. Steingart bestreitet die Zahlen.
Dem "Spiegel" zufolge habe das Charter-Geschäft mitunter "auch Vorrang vor journalistischen Belangen". Demnach musste die Pioneer-Redaktion ab dem 25. April für sechs Wochen von Bord, weil die Pioneer One an die Commerzbank verchartert war. Am Ende "ist The Pioneer auch nur ein Startup, das Geld verbrennt und deshalb dringend Umsatz für eine Wachstumsgeschichte machen muss", bilanziert der "Spiegel".
Steingart hatte einen "Spiegel"-Fragenkatalog, inklusive der Antworten von Pioneer-CEO Ingo Rieper am Mittwoch vorab veröffentlicht. Das Magazin schreibt dazu, dass Steingart "auf journalistische Standesgepflogenheiten nicht mehr viel gibt" und ihn die "Recherchen offenbar härter getroffen" hätten, "als er wohl zugeben mag". (Foto: Jörg Carstensen / Picture Alliance)
spiegel.de (€), turi2.de (Background)
 Im falschen Film: Der ORF hat in einen Nachrichtenbeitrag über Zwangsrekrutierung in der Ukraine Videos gezeigt, die aus einem anderen Zusammenhang stammen, deckt das Faktencheck-Portal Mimikama auf. Zu sehen seien die Verhaftung eines russischen Agenten sowie die Abführung eines Demonstranten. Der ORF bedauert den Fehler und will ihn zum Anlass nehmen, sich im Programm dem Thema "Fake-News im Informationskrieg" zu widmen.
Im falschen Film: Der ORF hat in einen Nachrichtenbeitrag über Zwangsrekrutierung in der Ukraine Videos gezeigt, die aus einem anderen Zusammenhang stammen, deckt das Faktencheck-Portal Mimikama auf. Zu sehen seien die Verhaftung eines russischen Agenten sowie die Abführung eines Demonstranten. Der ORF bedauert den Fehler und will ihn zum Anlass nehmen, sich im Programm dem Thema "Fake-News im Informationskrieg" zu widmen.
derstandard.at, puls24.at

He said, she said: Der "Spiegel" wehrt sich auf Nachfrage von "Meedia" gegen Vorwürfe des Medien-Startups Media Pioneer von Gabor Steingart, wonach sich das Magazin von der Bill und Melinda Gates Stiftung aushalten und beeinflussen lasse. Für das von der Stiftung finanzierte Projekt "Globale Gesellschaft" gebe es klare Richtlinien, eine redaktionelle Einflussnahme der Geldgeber sei ausgeschlossen, Texte des Projekts würden gekennzeichnet. Steingart schreibt in seinem Newsletter "Spiegel"-Gründer Rudolf Augstein "würde sich im Grab umdrehen, angesichts dieses Verrats an der Unabhängigkeit".
Auch dem Vorwurf, in Podcasts würden "Spiegel"-Redakteurinnen Werbebotschaften Dritter vorlesen, widerspricht das Magazin. Das treffe lediglich auf Eigenwerbung zu. Der "Spiegel" hatte im Vorfeld der Vorwürfe zum Geschäftsmodell von Media Pioneer recherchiert und wirft dem Startup anscheinend eine Vermischung von wirtschaftlichen Interessen und redaktioneller Arbeit vor. Die Recherche ist bisher nicht veröffentlicht.
meedia.de (€), turi2.de (Background)
 Angriff ist die beste Verteidigung: Pioneer-Boss Gabor Steingart geht gegen seinen Ex-Arbeitgeber "Spiegel" in die Offensive und veröffentlicht einen Katalog von 99 Fragen des Magazins an The Pioneer und den kommerziellen Arm Media Pioneer Publishing AG. Die Fragen drehen sich um das Geschäftsmodell Steingarts, die Vermietung des Medienschiffs an Firmenkunden und die Abbildung von Kunden-Events in den redaktionellen Pioneer-Newslettern und -Podcasts. CEO Ingo Rieper widerspricht den Vorwürfen der Vermischung von kommerziellen Interessen und redaktioneller Arbeit. Steingart wirft dem "Spiegel" in seinem Newsletter im Gegenzug vor, sich von der Bill & Melinda Gates Foundation mit 760.000 Euro pro Jahr "aushalten" zu lassen.
Angriff ist die beste Verteidigung: Pioneer-Boss Gabor Steingart geht gegen seinen Ex-Arbeitgeber "Spiegel" in die Offensive und veröffentlicht einen Katalog von 99 Fragen des Magazins an The Pioneer und den kommerziellen Arm Media Pioneer Publishing AG. Die Fragen drehen sich um das Geschäftsmodell Steingarts, die Vermietung des Medienschiffs an Firmenkunden und die Abbildung von Kunden-Events in den redaktionellen Pioneer-Newslettern und -Podcasts. CEO Ingo Rieper widerspricht den Vorwürfen der Vermischung von kommerziellen Interessen und redaktioneller Arbeit. Steingart wirft dem "Spiegel" in seinem Newsletter im Gegenzug vor, sich von der Bill & Melinda Gates Foundation mit 760.000 Euro pro Jahr "aushalten" zu lassen.
thepioneer.de
 Friedriches Schweigen: Der Verleger der "Berliner Zeitung", Holger Friedrich, rät Führungskräften davon ab, mit Medien zu sprechen. Die "Financial Times" zitiert ihn in einem Artikel Anfang August mit den Worten: "Ich würde jeder Person, die Verantwortung trägt oder [in der Öffentlichkeit] exponiert ist, raten, den Kontakt mit den meisten Journalisten zu vermeiden." "Süddeutsche"-Medienredakteurin "Anna Ernst, die das pikante Zitat aufgreift, mutmaßt, Friedrich habe womöglich "nie verstanden", wie das Mediengeschäft funktioniert.
Friedriches Schweigen: Der Verleger der "Berliner Zeitung", Holger Friedrich, rät Führungskräften davon ab, mit Medien zu sprechen. Die "Financial Times" zitiert ihn in einem Artikel Anfang August mit den Worten: "Ich würde jeder Person, die Verantwortung trägt oder [in der Öffentlichkeit] exponiert ist, raten, den Kontakt mit den meisten Journalisten zu vermeiden." "Süddeutsche"-Medienredakteurin "Anna Ernst, die das pikante Zitat aufgreift, mutmaßt, Friedrich habe womöglich "nie verstanden", wie das Mediengeschäft funktioniert.
ft.com (€), sueddeutsche.de (€), kress.de
 Rendezvous mit Hindernissen: Die Produktionsfirma Constantin reagiert auf die Kritik von Autorin Rita Falk bezüglich der Verfilmung ihres Buchs "Rehragout-Rendezvous". Man schätze Falk und ihre Arbeit sehr, sagt Chef Martin Moszkowicz der Nachrichtenagentur dpa. Die aktuelle Berichterstattung sei "bedauerlich", da man "seit über zehn Jahren respektvoll und vertrauensvoll" zusammenarbeite. Als Produktionsfirma müsse Constantin jedoch "die Interessen aller an einer Verfilmung beteiligten Künstler respektieren und koordinieren".
Rendezvous mit Hindernissen: Die Produktionsfirma Constantin reagiert auf die Kritik von Autorin Rita Falk bezüglich der Verfilmung ihres Buchs "Rehragout-Rendezvous". Man schätze Falk und ihre Arbeit sehr, sagt Chef Martin Moszkowicz der Nachrichtenagentur dpa. Die aktuelle Berichterstattung sei "bedauerlich", da man "seit über zehn Jahren respektvoll und vertrauensvoll" zusammenarbeite. Als Produktionsfirma müsse Constantin jedoch "die Interessen aller an einer Verfilmung beteiligten Künstler respektieren und koordinieren".
spiegel.de, turi2.de (Background)

Rehvanche: Die Autorin der Eberhofer-Krimis, Rita Falk, ist unglücklich mit der Verfilmung ihres Buchs "Rehragout-Rendezvous", die heute im Kino anläuft. "Als Autorin muss ich mich distanzieren von diesem Film", sagt sie dem "Spiegel". Es gehe auch darum, ihren Ruf zu schützen. Nach der "viele Jahre lang großartigen" Zusammenarbeit seien ihre "Einsprüche irgendwann nicht mehr zur Kenntnis genommen" worden, inbesondere beim neuen Film. Das Drehbuch sei "unglaublich platt, trashig, stellenweise sogar ordinär", ihr sei "vieles an dem Film völlig fremd". Constantin habe noch eine Option auf zwei ältere Bücher, weiteren Verfilmungen stehe sie nun "sehr skeptisch gegenüber".
spiegel.de (€), dwdl.de
 Prechtsaußen? Journalist Andrej Reisin wirft Markus Lanz und Richard David Precht bei Übermedien vor, in ihrem ZDF-Podcast Lanz & Precht Narrative zu bedienen, "die die AfD so oder so ähnlich auch vertritt". Er fragt sich, warum unter dem Label der "heute"-Nachrichten, wo der Podcast bei YouTube läuft", "andauernd faktisch falscher Unsinn verbreitet werden darf". Lanz und Precht glänzten mit "gefährlichem Halbwissen" und "bräsiger Arroganz". Gerade der öffentlich-rechtliche Rundfunk hätte jedoch "jede Pflicht und Schuldigkeit und vor allem auch Möglichkeit, es besser zu machen".
Prechtsaußen? Journalist Andrej Reisin wirft Markus Lanz und Richard David Precht bei Übermedien vor, in ihrem ZDF-Podcast Lanz & Precht Narrative zu bedienen, "die die AfD so oder so ähnlich auch vertritt". Er fragt sich, warum unter dem Label der "heute"-Nachrichten, wo der Podcast bei YouTube läuft", "andauernd faktisch falscher Unsinn verbreitet werden darf". Lanz und Precht glänzten mit "gefährlichem Halbwissen" und "bräsiger Arroganz". Gerade der öffentlich-rechtliche Rundfunk hätte jedoch "jede Pflicht und Schuldigkeit und vor allem auch Möglichkeit, es besser zu machen".
uebermedien.de (€)
 "Da wird suggeriert, dass das der Party-Schlager ist, der auf Mallorca läuft. Aber da wird ganz viel altes, weichgespültes Zeug wieder hochgeholt, alles, was keinem wehtut."
"Da wird suggeriert, dass das der Party-Schlager ist, der auf Mallorca läuft. Aber da wird ganz viel altes, weichgespültes Zeug wieder hochgeholt, alles, was keinem wehtut."
Schlager-Sänger Ikke Hüftgold wettert im Interview mit Ippen Medien gegen die Mallorca-Ausgabe des "ZDF-Fernsehgartens". Seinen Auftritt am 30. Juli sagt er ab und schlägt als neuen Namen "lustiger Nachmittag mit Musik, die keinem wehtut" vor.
merkur.de via wunschliste.de
 Quatsch aus Hollywood: Moderator Günther Jauch wehrt sich gegen offenbar satirisch gemeinte Zitate von Tom und Bill Kaulitz, die in der Klatschpresse als Fakten kursieren. In ihrem Podcast Kaulitz Hills hatten die Musiker behauptet, sie seien mit Jauch eine Nacht lang durch die Club-Szene Berlins gezogen. Jauch widerspricht dieser Aussage im Podcast von Kurt Krömer: "Ich war noch nie in einem Technoclub." Die RTL-Zeitschrift "Gala" habe in der Sache bereits eine Gegendarstellung veröffentlicht, schreibt der "Spiegel". Gegen die Verlage Bauer und SCG laufen Verfahren, schreibt "Bild".
Quatsch aus Hollywood: Moderator Günther Jauch wehrt sich gegen offenbar satirisch gemeinte Zitate von Tom und Bill Kaulitz, die in der Klatschpresse als Fakten kursieren. In ihrem Podcast Kaulitz Hills hatten die Musiker behauptet, sie seien mit Jauch eine Nacht lang durch die Club-Szene Berlins gezogen. Jauch widerspricht dieser Aussage im Podcast von Kurt Krömer: "Ich war noch nie in einem Technoclub." Die RTL-Zeitschrift "Gala" habe in der Sache bereits eine Gegendarstellung veröffentlicht, schreibt der "Spiegel". Gegen die Verlage Bauer und SCG laufen Verfahren, schreibt "Bild".
open.spotify.com (58-Min-Podcast), spiegel.de, bild.de (€)
 Weidel-Erwiderung: "stern"-Chefredakteur Gregor Peter Schmitz reagiert im Editorial auf Kritik am großen Interview mit AfD-Chefin Alice Weidel vor einer Woche. Ihn irritiere "die Selbstgewissheit derer, die unseren Ansatz – mit der AfD streiten, auch in einem Interview – so pauschal verurteilen". Medien müssten sich überlegen, "wie wir die Leere der Populisten aufdecken, ohne bevormundend zu wirken". Das gelinge mal besser, mal weniger gut, "aber der Versuch sollte normal werden". Über die Frage des richtigen Umgangs mit der AfD diskutieren im Heft auch Politik-Wissenschaftlerin Natascha Strobl und Autor Hasnain Kazim.
Weidel-Erwiderung: "stern"-Chefredakteur Gregor Peter Schmitz reagiert im Editorial auf Kritik am großen Interview mit AfD-Chefin Alice Weidel vor einer Woche. Ihn irritiere "die Selbstgewissheit derer, die unseren Ansatz – mit der AfD streiten, auch in einem Interview – so pauschal verurteilen". Medien müssten sich überlegen, "wie wir die Leere der Populisten aufdecken, ohne bevormundend zu wirken". Das gelinge mal besser, mal weniger gut, "aber der Versuch sollte normal werden". Über die Frage des richtigen Umgangs mit der AfD diskutieren im Heft auch Politik-Wissenschaftlerin Natascha Strobl und Autor Hasnain Kazim.
"stern" 28/2023, S. 3 (€, Editorial) und 40 - 43 (€, Streitgespräch), turi2.de (Background)
 Nicht genug gespart: Der Chef der sächsischen Staatskanzlei, Oliver Schenk, vermisst in den Reform-Plänen der ARD ernsthaften Sparwillen. Der "FAZ" sagt Schenk: "Effizienz besteht im ARD-Verständnis anscheinend nur in der besseren Nutzung vorhandener Ressourcen, nicht aber in deren Verringerung." Er fordert u.a. den Abbau von Doppelstrukturen, maßvolle Gehälter, mehr Regionalität und weniger Haltungsjournalismus. Das Programm empfänden viele "als belehrend und unausgewogen", klagt Schenk.
Nicht genug gespart: Der Chef der sächsischen Staatskanzlei, Oliver Schenk, vermisst in den Reform-Plänen der ARD ernsthaften Sparwillen. Der "FAZ" sagt Schenk: "Effizienz besteht im ARD-Verständnis anscheinend nur in der besseren Nutzung vorhandener Ressourcen, nicht aber in deren Verringerung." Er fordert u.a. den Abbau von Doppelstrukturen, maßvolle Gehälter, mehr Regionalität und weniger Haltungsjournalismus. Das Programm empfänden viele "als belehrend und unausgewogen", klagt Schenk.
zeitung.faz.net (€)
 "Wenn die satirische Kenntlichmachung der Beziehungen zwischen politischen Verantwortlichen und Funktionsträgern der Wirtschaft, der Versuch, einzelne Komponenten des Systems unter selbstverachtendem Einsatz vermeintlich krachlustiger Perücken darzustellen, wenn das Paarlaufen von Andi Scheuer und Sir Isaac Neffton zum Zweck der Illustration der Unfähigkeit und Korruption des leitenden Personals keine Kapitalismuskritik ist, was zum Henker machen wir da eigentlich die ganze Zeit?"
"Wenn die satirische Kenntlichmachung der Beziehungen zwischen politischen Verantwortlichen und Funktionsträgern der Wirtschaft, der Versuch, einzelne Komponenten des Systems unter selbstverachtendem Einsatz vermeintlich krachlustiger Perücken darzustellen, wenn das Paarlaufen von Andi Scheuer und Sir Isaac Neffton zum Zweck der Illustration der Unfähigkeit und Korruption des leitenden Personals keine Kapitalismuskritik ist, was zum Henker machen wir da eigentlich die ganze Zeit?"
Kabarettist Max Uthoff reagiert in der "Kontext"-Wochenzeitung auf den Vorwurf von Kabarett-Kollegin Christine Prayon, Satire-Sendungen wie "Die Anstalt" würden keine ernstgemeinte Kapitalismuskritik zulassen.
kontextwochenzeitung.de, turi2.de (Background)
(Foto: Michel Neumeister)
 Hör-Tipp: Im Medienmagazin von Radioeins diskutiert Jörg Wagner mit Gästen, was sich ein Jahr nach den ersten Meldungen zum RBB-Skandal um Patricia Schlesinger im Sender getan hat. Dabei kommt anonym auch eine freie Mitarbeiterin zu Wort, die unverblümt Kritik äußert: Seit 25 Jahren werde gespart, "bis alles kaputt ist". Der öffentlich-rechtliche Rundfunk sei ein "Riesen-Tanker", bei dem "ein Sonnendeck und noch ein Sonnendeck" eingezogen werde. Oben trinke man Champagner, unten "sitzen die Galeeren-Sklaven und rudern um ihr Leben".
Hör-Tipp: Im Medienmagazin von Radioeins diskutiert Jörg Wagner mit Gästen, was sich ein Jahr nach den ersten Meldungen zum RBB-Skandal um Patricia Schlesinger im Sender getan hat. Dabei kommt anonym auch eine freie Mitarbeiterin zu Wort, die unverblümt Kritik äußert: Seit 25 Jahren werde gespart, "bis alles kaputt ist". Der öffentlich-rechtliche Rundfunk sei ein "Riesen-Tanker", bei dem "ein Sonnendeck und noch ein Sonnendeck" eingezogen werde. Oben trinke man Champagner, unten "sitzen die Galeeren-Sklaven und rudern um ihr Leben".
ardaudiothek.de (48-Min-Audio + Bonus-Material, Mitarbeiterin bei 33:12 Min), businessinsider.de (Text-Zusammenfassung)
 Wer hat's gesehen? Kabarettistin Christine Prayon erzählt der Wochenzeitung "Kontext", sie würde sich "noch gut erinnern", wie Jan Böhmermann im "ZDF Magazin Royale" Nichtgeimpften "zwei Stinkefinger" gezeigt habe. Auf "Spiegel"-Nachfrage sagt die Redaktion, man habe einen entsprechenden Ausschnitt nicht gefunden und könne sich an Mittelfinger gegen Ungeimpfte nicht erinnern. Ihren Rückzug aus der "heute-show" begründet Prayon mit Stimmungsmache "gegen Andersdenkende".
Wer hat's gesehen? Kabarettistin Christine Prayon erzählt der Wochenzeitung "Kontext", sie würde sich "noch gut erinnern", wie Jan Böhmermann im "ZDF Magazin Royale" Nichtgeimpften "zwei Stinkefinger" gezeigt habe. Auf "Spiegel"-Nachfrage sagt die Redaktion, man habe einen entsprechenden Ausschnitt nicht gefunden und könne sich an Mittelfinger gegen Ungeimpfte nicht erinnern. Ihren Rückzug aus der "heute-show" begründet Prayon mit Stimmungsmache "gegen Andersdenkende".
spiegel.de via twitter.com/antonrainer, turi2.de (Background)
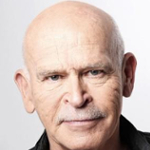 "Was Habeck angeht, sehe ich bei 'Bild' nicht nur eine Kampagne, sondern schon einen Vernichtungsjournalismus."
"Was Habeck angeht, sehe ich bei 'Bild' nicht nur eine Kampagne, sondern schon einen Vernichtungsjournalismus."
Investigativ-Journalist Günter Wallraff kritisiert in einem Streitgespräch mit Kai Diekmann in der "Zeit", dass "Bild" "im Kern immer noch dieselbe Zeitung" wie damals sei, "mit allen Rückfällen, mit allen Exzessen". In Diekmanns Buch "Ich war Bild" vermisse er "die finsteren Seiten" des Blattes. Stattdessen präsentiere sich Diekmann "ausnahmslos als der Größte und Gerechteste".
zeit.de (€)
 "Schriftliche, also autorisierte, Interviews funktionieren bei Menschen, die lügen, einfach nicht. Da kann man dann noch so hoffen, dass es sich 'entzaubert' oder selbst erklärt, wenn Weidel einfach lügt, dass es keine Rechtsextremen in der AfD gibt."
"Schriftliche, also autorisierte, Interviews funktionieren bei Menschen, die lügen, einfach nicht. Da kann man dann noch so hoffen, dass es sich 'entzaubert' oder selbst erklärt, wenn Weidel einfach lügt, dass es keine Rechtsextremen in der AfD gibt."
"Spiegel"-Journalistin Ann-Katrin Müller, die seit mehr als vier Jahren über die AfD berichtet, kritisiert in einem Twitter-Thread, dass der "stern" AfD-Chefin Alice Weidel "sehr breiten Raum gibt", zu erklären, "welch grandioses Programm die AfD doch habe". Dabei sei das Parteiprogramm "weder in sich stimmig noch finanzierbar".
twitter.com, turi2.de (Background)
 Video-Tipp: Seit 17 Jahren verspricht "Germany's next Topmodel", allen voran Model-Mutti Heidi Klum, tausenden jungen Frauen die Chance auf eine Weltkarriere, auf ein Leben in Ruhm und Reichtum. Im Funk-Format Strg_F sprechen neun Ex-Teilnehmerinnen vor der Kamera über ihre Erfahrungen mit der Show. Einige berichten von einer schönen Zeit, andere von Überforderung, Druck, Manipulation am Set und sogar Morddrohungen nach der Sendung.
Video-Tipp: Seit 17 Jahren verspricht "Germany's next Topmodel", allen voran Model-Mutti Heidi Klum, tausenden jungen Frauen die Chance auf eine Weltkarriere, auf ein Leben in Ruhm und Reichtum. Im Funk-Format Strg_F sprechen neun Ex-Teilnehmerinnen vor der Kamera über ihre Erfahrungen mit der Show. Einige berichten von einer schönen Zeit, andere von Überforderung, Druck, Manipulation am Set und sogar Morddrohungen nach der Sendung.
youtube.com (74-Min-Video)
 "Man kann natürlich alle drei Minuten das Bisschen wiederholen, was man weiß. Und hinzufügen: Den Rest wissen wir nicht. Man kann auch die ganze Zeit eine Straßenszene in Moskau zeigen und spekulieren, was wohl passieren wird, wenn die Truppen einmarschieren. Aber das darf doch nicht unser Anspruch sein."
"Man kann natürlich alle drei Minuten das Bisschen wiederholen, was man weiß. Und hinzufügen: Den Rest wissen wir nicht. Man kann auch die ganze Zeit eine Straßenszene in Moskau zeigen und spekulieren, was wohl passieren wird, wenn die Truppen einmarschieren. Aber das darf doch nicht unser Anspruch sein."
ARD-Chefredakteur Oliver Köhr begründet im "Spiegel"-Interview, warum Das Erste beim Aufstand der Wagner-Söldner am Samstag nicht sofort auf Dauer-Sondersendung umgeschaltet hat.
spiegel.de (€), turi2.de (Background)
 "Wie groß muss die Sehnsucht danach sein, gestandenen TV-Moderatorinnen dabei zuzusehen, wie sie unüberschaubare Ereignisse und Bilder kurz nach Bekanntwerden live kommentieren? Meistens, ohne davor auch nur einige Sekunden das Geschehen reflektieren zu können. Was genau verspricht man sich davon?"
"Wie groß muss die Sehnsucht danach sein, gestandenen TV-Moderatorinnen dabei zuzusehen, wie sie unüberschaubare Ereignisse und Bilder kurz nach Bekanntwerden live kommentieren? Meistens, ohne davor auch nur einige Sekunden das Geschehen reflektieren zu können. Was genau verspricht man sich davon?"
"Spiegel"-Autor Jonas Leppin nimmt ARD und ZDF dafür in Schutz, beim Aufstand der Wagner-Söldner nicht sofort ihre Hauptprogramme unterbrochen zu haben. Kritikern bei Twitter gehe es wohl in erster Linie "um das simple Bashen der Öffentlich-Rechtlichen".
spiegel.de
 Der Papa macht 'ne Ansage: Model-Manager Günther Klum, Vater von Heidi Klum, wirft ProSieben vor dem Finale von "Germany's Next Topmodel" vor, an Geld und Ideen für die Show zu sparen. In einem Video-Statement aus dem Garten kritisiert er, dass das Finale statt wie einst in einer großen Halle nur noch im Studio produziert werde und das junge Publikum mit den Scorpions als Musik-Act "nichts anfangen" könne. Er schlägt vor, künftig auch "schöne junge Männer" an der Show teilnehmen zu lassen.
Der Papa macht 'ne Ansage: Model-Manager Günther Klum, Vater von Heidi Klum, wirft ProSieben vor dem Finale von "Germany's Next Topmodel" vor, an Geld und Ideen für die Show zu sparen. In einem Video-Statement aus dem Garten kritisiert er, dass das Finale statt wie einst in einer großen Halle nur noch im Studio produziert werde und das junge Publikum mit den Scorpions als Musik-Act "nichts anfangen" könne. Er schlägt vor, künftig auch "schöne junge Männer" an der Show teilnehmen zu lassen.
klum.com (3-Min-Video) via t-online.de
 Hör-Tipp: "Monitor"-Chef Georg Restle warnt im Podcast Läuft von epd Medien und dem Grimme-Institut davor, journalistische Inhalte immer stärker unterhaltsam zu verpacken. Das "ZDF Magazin Royale" von Jan Böhmermann oder "Reschke Fernsehen" mit Anja Reschke seien "wunderbare Formate", aber dürften "niemals Leitbild werden für einen Journalismus, der in dieser Gesellschaft ernst genommen werden will". Formate mit "subjektiv-emotionalem" Blick wie bei Funk hätten ihre Berechtigung, jedoch dürfe gerade der öffentliche Rundfunk "nicht nur noch darauf setzen".
Hör-Tipp: "Monitor"-Chef Georg Restle warnt im Podcast Läuft von epd Medien und dem Grimme-Institut davor, journalistische Inhalte immer stärker unterhaltsam zu verpacken. Das "ZDF Magazin Royale" von Jan Böhmermann oder "Reschke Fernsehen" mit Anja Reschke seien "wunderbare Formate", aber dürften "niemals Leitbild werden für einen Journalismus, der in dieser Gesellschaft ernst genommen werden will". Formate mit "subjektiv-emotionalem" Blick wie bei Funk hätten ihre Berechtigung, jedoch dürfe gerade der öffentliche Rundfunk "nicht nur noch darauf setzen".
laeuft-programmschau.podigee.io (17-Min-Audio) via evangelische-zeitung.de
 Falsch verstandene Solidarität: Nach den Razzien bei der Letzten Generation vergangene Woche machte eine dpa-Meldung die Runde, die Vereinten Nationen würden die Gruppe unterstützen und das Vorgehen der deutschen Justiz "beobachten". Tatsächlich hatte Stephane Dujarric, Sprecher von UN-Generalsekretär António Guterres, bei einer Pressekonferenz salomonisch geantwortet, friedliche Proteste hätten bereits Fortschritte beim Kampf gegen den Klimawandel bewirkt, kommentiert Joachim Krause in der "FAZ". Der Direktor des Instituts für Sicherheitspolitik der Uni Kiel wirft der dpa vor, Dujarric "selektiv zitiert" zu haben, so dass der Eindruck entstehen konnte, er habe die Letzte Generation in Schutz genommen. "Das war unprofessioneller Meinungsjournalismus", urteilt Krause.
Falsch verstandene Solidarität: Nach den Razzien bei der Letzten Generation vergangene Woche machte eine dpa-Meldung die Runde, die Vereinten Nationen würden die Gruppe unterstützen und das Vorgehen der deutschen Justiz "beobachten". Tatsächlich hatte Stephane Dujarric, Sprecher von UN-Generalsekretär António Guterres, bei einer Pressekonferenz salomonisch geantwortet, friedliche Proteste hätten bereits Fortschritte beim Kampf gegen den Klimawandel bewirkt, kommentiert Joachim Krause in der "FAZ". Der Direktor des Instituts für Sicherheitspolitik der Uni Kiel wirft der dpa vor, Dujarric "selektiv zitiert" zu haben, so dass der Eindruck entstehen konnte, er habe die Letzte Generation in Schutz genommen. "Das war unprofessioneller Meinungsjournalismus", urteilt Krause.
faz.net